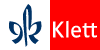Lexikon
Rilke, Rainer Maria (eigtl. René M. R.)
Drucken* 4. 12. 1875 in Prag
† 29. 12. 1926 in Val Mont bei Montreux
„So sind Sie nun, großer Meister, für mich unsichtbar geworden, entrückt wie durch eine Himmelfahrt in die Sphären, die die Ihren sind“, schrieb Rilke im Mai 1906 an den Bildhauer Auguste Rodin, nachdem dieser ihn entlassen hatte. „Ich werde Sie nicht mehr sehen – doch, wie für Apostel, die betrübt und allein zurückblieben, beginnt jetzt das Leben für mich (…).“ Über den unmittelbaren Anlass hinaus verweist diese briefliche Äußerung auf eine Grundsituation in Rilkes Leben und Werk: die Empfindung von Einsamkeit und Verlust. Im „Namenlosen“ der Wirklichkeit nähert sich die Dichtung „Gott, dem nicht mehr Sagbaren“.
Der Sohn eines Bahnbeamten besuchte in seiner Heimatstadt die Militärschule, holte das Abitur nach und studierte an der Prager Universität Philosophie, Kunst- und Literaturgeschichte, 1894 wandte er sich der Dichtung zu. 1896 lernte Rilke in München die Schriftstellerin Lou Andreas-Salomé kennen, mit der er sich 1897 in Berlin niederließ und 1899 sowie 1900 zwei ausgedehnte Russlandreisen unternahm. 1899 entstand die in rhythmisierter Prosa gestaltete Novelle Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke (V 1906), eine durch Familienüberlieferung angeregte Schilderung der ersten Liebe und des Soldatentods eines jungen Offiziers in Ungarn zur Zeit der Türkenkriege.
1900 ließ sich Rilke in der Künstlerkolonie Worpswede bei Bremen nieder und heiratete 1901 die Bildhauerin Clara Westhoff (Rilke-Bildnis von Paula Modersohn-Becker, 1903 erschien Rilkes Monografie Worpswede). 1902/03 und 1905/06 stand er in Paris und Meudon mit Rodin in Beziehung, zuletzt als dessen Privatsekretär, dazwischen lagen Reisen nach Italien und Schweden sowie der Beginn der Arbeit am Roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (V 1910). Rodin wurde für den Dichter zum Lehrmeister: Er leitete Rilke an, sich der konkreten Gegenständlichkeit zuzuwenden (Neue Gedichte, 1907; im selben Jahr erschien der Vortrag über Rodin aus dem Jahr 1905). Ab 1906 führte Rilke ein unruhiges Reiseleben mit Aufenthalten in Dtl., Böhmen, Italien, Spanien, Nordafrika und Paris (1908–10); 1911 folgte er der Einladung der Fürstin Marie von Thurn und Taxis auf Schloss Duino an der Adria (1912 Beginn der Arbeit an den Duineser Elegien), 1913 hielt er sich erneut in Paris auf (Versöhnung mit Rodin), 1919 siedelte er von München aus (hier erlebte er Revolution und Räterepublik) in die Schweiz über. Ab 1921 lebte er auf Schloss Muzot bei Siders im Wallis; hier vollendete er 1922 die Duineser Elegien und 1923 Die Sonette an Orpheus.
Die Korrespondenz verstand Rilke als „Mittel des Umgangs (…), der schönsten und ergiebigsten eines“; posthum erschienen die Briefe an einen jungen Dichter (Franz Xaver Kappus, E 1903/04 und 1908, V 1929) und die Briefe an eine junge Frau (Lisa Heise, E 1919–24, V 1930).
Gedichtbände: Das Buch der Bilder (1902), Das Stunden-Buch (1905), Neue Gedichte (1907), Der neuen Gedichte anderer Teil (1908), Die frühen Gedichte (1909), Requiem (1909), Erste Gedichte (1913), Das Marienleben (1913), Duineser Elegien (1923), Die Sonette an Orpheus (1923), Späte Gedichte (posthum 1934).
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Tagebuchroman, E ab 1904, V 1910.
In der Form von Tagebuchaufzeichnungen entwickelt der Roman die Gestalt des 28-jährigen Dänen adliger Herkunft Brigge, der nach dem Verlust der Eltern und des Familienbesitzes in Paris als Dichter lebt. Ein wesentliches Kompositionsmittel bildet die Kontrastierung von Gegenwart und erinnerter Vergangenheit. Das gegenwärtige Erleben wird durch die Großstadt Paris bestimmt. Sie zeigt sich in Bildern von Armut, Krankheit, Zerstörung und Tod. Diese verbinden sich mit dem Bewusstsein Brigges vom Aussterben seines Geschlechts. Die Gegenbilder entstammen der Erinnerung an die Kindheit auf Schloss Ulsgaard und an ein Kloster, den Sitz der mütterlichen Familie. Die Kindheit ist jedoch kein entfernter, in sich geschlossener Erlebnisraum, sondern enthält auch in der Gegenwart nachwirkende und auf die Zukunft vorausweisende „okkulte Begebnisse“; Malte spricht von einer noch „ungetanen Kindheit“. In diesem Zusammenhang steht die Liebe zur Mutter und zu deren jüngerer Schwester Abelone.
Die Überwältigung durch die disparaten Wahrnehmungen des Großstadtlebens bringt die folgende Nachtszene zum Ausdruck: „Dass ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen rasen läutend durch meine Stube. Automobile gehen über mich hin.
Eine Tür fällt zu. Irgendwo klirrt eine Scheibe herunter, ich höre ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlich dumpfer, eingeschlossener Lärm von der anderen Seite, innen im Hause. Jemand steigt die Treppe. Kommt unaufhörlich. Ist da, ist lange da, geht vorbei. Und wieder die Straße. Ein Mädchen kreischt: Ah tais-toi, je ne veux plus. Die Elektrische rennt ganz erregt heran, darüber fort, fort über alles. Jemand ruft. Leute laufen, überholen sich. Ein Hund bellt. Was für eine Erleichterung: ein Hund.“
Der Impressionismus dieses modernen „Nachtstücks“ erweitert sich zur Empfindung der Rätselhaftigkeit der Welt, die zur Loslösung von der Oberflächenerscheinung zwingt. Mit dem „Scheinwerfer seines Herzens“ versucht Brigge, einen „Innenraum“ zu erhellen. Dies findet seinen Ausdruck im Überwiegen von Reflexionen Brigges im zweiten Teil des Romans. Sie münden in einer Parabel in Gestalt einer völligen Umdeutung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn in eine „Legende dessen, der nicht geliebt werden wollte“. Der Trennung von der als ichsüchtig erlebten Familie liegt das Ziel zugrunde, nicht „ihr ungefähres Leben nachlügen“ zu müssen. Sein Leben in der Fremde befähigt den „verlorenen Sohn“ schließlich, als ein ihr Entfremdeter in die Familie zurückzukehren: „Was wussten sie, wer er war. Er war jetzt furchtbar schwer zu lieben, und er fühlte, dass nur Einer dazu imstande war. Der aber wollte noch nicht.“
Der Roman endet somit in einer Frage, einer Erwartung. Dies gilt auch für die Reflexion der Darstellungsform. Brigge bzw. Rilke ist zunächst von der Überzeugung durchdrungen: „Dass man erzählte, wirklich erzählte, das muss vor meiner Zeit gewesen sein“ (vgl. Hofmannsthals Sprachpessimismus in Ein Brief). Zugleich kommt die in die Zukunft gerichtete Hoffnung zum Ausdruck: „Die Zeit der anderen Auslegung wird anbrechen, und es wird kein Wort mehr auf dem anderen bleiben.“
Die Modernität des Werks beruht einerseits auf inhaltlichen Aussagen, in denen beispielsweise das Bewusstsein von der „Existenz des Entsetzlichen“ zum Ausdruck kommt, das sich unwillkürlich im Menschen niederschlägt, denn „alles, was sich an Qual und Grauen begeben hat (…): alles das besteht auf sich und hängt, eifersüchtig auf alles Seiende, an seiner schrecklichen Wirklichkeit“. Andererseits hat Rilke mit einer bis dahin unbekannten Konsequenz die herkömmliche Form des Epischen aufgehoben und literarisches Neuland erschlossen.
Lyrik. Wie Hofmannsthal trat Rilke als junger Lyriker mit George als dem entschiedenen Gegner einer epigonalen oder naturalistischen Veräußerlichung der Sprache in Verbindung (erste Begegnung in Berlin 1897). Berührungspunkte ergaben sich durch das Ziel, aus Bildern der inneren Anschauung eine neue dichterische Welt der Bilder zu erschaffen. Im „Eingang“ zur Slg. Das Buch der Bilder (E ab 1898, V 1902 heißt es: „Mit deinen Augen, welche müde kaum/von der verbrauchten Schwelle sich befrein,/hebst du ganz langsam einen schwarzen Baum/und stellst ihn vor den Himmel: schlank, allein. / Und hast die Welt gemacht. Und sie ist groß / und wie ein Wort, das noch im Schweigen reift.“ Als Ausdruck des in Russland gewonnenen neuen Verständnisses des Religiösen als Demut und Brüderlichkeit entstand ab 1899 die Slg. Das Stunden-Buch (V 1905), gegliedert in die 3 Teile Vom mönchischen Leben, Von der Pilgerschaft und Von der Armut und dem Tode. Die Lyrik drängt zum Bekenntnis der Gottesschau: „Ich finde dich in allen diesen Dingen,/denen ich gut und wie ein Bruder bin;/als Samen sonnst du dich in den geringen,/Und in den großen gibst du groß dich hin.“ Die Andacht wechselt mit der Kritik der modernen Lebensverhältnisse: „Die Städte aber wollen nur das Ihre/und reißen alles mit in ihren Lauf. / Wie hohles Holz zerbrechen sie die Tiere / und brauchen viele Völker brennend auf.“ Die Menschen „nennen Fortschritt ihre Schneckenspuren“, sie „fühlen sich und funkeln wie die Huren / und lärmen lauter mit Metall und Glas“.
Nicht zuletzt unter dem Eindruck des Umgangs mit bildenden Künstlern (Künstlerkolonie Worpswede, Rodin) gelangte Rilke zur Anerkennung des Eigenwerts der sinnlichen Wahrnehmung. Sie überwiegt in den Gedichten der Slg. Neue Gedichte (2 Teile, 1907 und 1908). Die sprachliche Gestaltung erschließt das Wesenhafte der äußeren Anschauung, beispielsweise eines in einem Käfig im Pariser Jardin des Plantes vegetierenden Panthers: „Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe / so müd geworden, dass er nichts mehr hält. / Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe / und hinter tausend Stäben keine Welt. / (…) Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille/sich lautlos auf –, dann geht ein Bild hinein, / geht durch der Glieder angespannte Stille – / und hört im Herzen auf zu sein.“
Der Hinwendung zur äußeren Erscheinungswelt folgte die Rückkehr zur inneren Anschauung: „Durch alle Wesen reicht der eine Raum: / Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still/durch uns hindurch. O, der ich wachsen will, / ich seh hinaus, und in mir wächst ein Baum.“ Rilke selbst sprach von einem Übergang von der Impression zur seelischen Expression: „Spanien war der letzte ‚Eindruck‘. Seither wird meine Natur von innen getrieben, stark und beständig, dass sie nicht mehr nur ‚eingedrückt‘ werden kann.“ Ausdruckslyrik sind die 1912 begonnenen und 1922 vollendeten zehn Duineser Elegien (V 1923) insofern, als sie schrittweise das Bekenntnis zur Erde als Inbegriff des Strebens nach Vergeistigung entfalten: „Erde, du liebe, ich will. Oh glaub, es bedürfte / nicht deiner Frühlinge mehr, mich dir zu gewinnen –, einer, / ach, ein einziger ist schon dem Blute zu viel“ (9. Elegie). Den Ausgangspunkt bildet das Bewusstsein von der ungeheuren Kluft zwischen dem Menschen und dem Göttlichen: „Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel / Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme / einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem / stärkeren Dasein“ (Beginn der 1. Elegie).
Während der Vollendung der Elegien entstanden die 55 Gedichte der Slg. Die Sonette an Orpheus (V 1923) mit dem Leitmotiv der Verwandlung: „(…) Jeder glückliche Raum ist Kind oder Enkel von Trennung, / den sie staunend durchgehn. Und die verwandelte Daphne/will, seit sie Lorbeern fühlt, dass du dich wandelst in Wind“ (12. Sonett des II. Teils).
Sie finden hier online folgende Texte von Rainer Maria Rilke:
Quelle: Ernst Klett Verlag GmbH
Ort: Stuttgart
Quellendatum: 2009
Ort: Stuttgart
Quellendatum: 2009
Autoren-Lexikon
Das Lexikon bietet Informationen zu allen in deutsch.kompetent erwähnten Autoren.