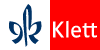Lexikon
Goethe, Johann Wolfgang
Drucken* 28. 8. 1749 in Frankfurt a. M.
† 22. 3. 1832 in Weimar
Goethe ist der einzige dt. Schriftsteller, nach dem eine Epoche benannt ist: die „Goethezeit“ vom Sturm und Drang bis zur Klassik und Romantik. Schon Heine betonte seine repräsentative Bedeutung, indem er 1831 von der „Kunstperiode“ sprach, „die bei der Wiege Goethes anfing und bei seinem Sarge enden wird“, sowie später, die Bezeichnung als „Dichterfürst“ steigernd, von der „Goetheschen Kaiserzeit“, die freilich auch von erbitterter Opposition etwa gegen den „Heiden“ Goethe gekennzeichnet war. Der „Olympier“ selbst zog kurz vor seinem Tode die Bilanz: „Wenn ich aber aussprechen soll, was ich den Deutschen überhaupt, besonders den jungen Dichtern geworden bin, so darf ich mich wohl ihren Befreier nennen; denn sie sind an mir gewahr geworden, dass, wie der Mensch von innen heraus leben, der Künstler von innen heraus wirken müsse, indem er, gebärde er sich wie er will, immer nur sein Individuum fördern will“ (Noch ein Wort für junge Dichter). Um diese Beziehung zwischen Ich und Welt kreist, als eine „einzige Konfession“, das in seiner Spannweite einzigartige Gesamtwerk des Lyrikers, Dramatikers, Erzählers, Literatur- und Kunstkritikers, Naturforschers und Zeichners, dessen Person und Schaffen ebenso oft mythisch überhöht wie „demaskiert“ worden ist.
Der Sohn des vermögenden privatisierenden Juristen Johann Kaspar Goethe (mit dem Ehrentitel eines kaiserlichen Rates) und der Tochter eines Frankfurter Schultheißen, Katharina Elisabeth Textor („Frau Rat“ gen.), erhielt seine Schulausbildung durch den Vater sowie Hauslehrer. 1765 begann er in Leipzig ein Jurastudium, das er 1768 wegen eines Lungenleidens abbrechen musste. Zu den Leipziger Lehrern gehörten Gottsched und (als Zeichenlehrer) Adam Friedrich Oeser, ein Anhänger des Klassizismus. Goethes literarische Frühwerke gehören dagegen dem Rokoko an: die Lieder der handschriftlichen Slg. Annette ebenso wie das Schäferspiel Die Laune des Verliebten (E 1767/68); als erste Veröffentlichung erschien 1769 die Slg. Neue Lieder. Während der Genesungszeit im Elternhaus stand Goethe unter dem Einfluss pietistischer und mystischer Schriften. 1770/71 brachte Goethe in Straßburg das Jurastudium zum Abschluss. Seine im Sturm und Drang gipfelnde neue Auffassung von Leben und Kunst entwickelte sich nicht zuletzt aus der durch Herder vermittelten Beschäftigung mit Homer, Shakespeare, Rousseau und der Volkspoesie. In der sog. Sesenheimer Lyrik (Liebe zu der Pfarrerstochter Friederike Brion) streifte Goethe alle Konventionen des Empfindungsausdrucks ab (Willkommen und Abschied). Im Aufsatz Von deutscher Baukunst (V 1772) huldigte er dem Genie des angeblichen Erbauers des Straßburger Münsters, Erwin von Steinbach. Im Sommer 1772 arbeitete der Advokat Goethe als Praktikant am Reichskammergericht in Wetzlar (Liebe zur verlobten Charlotte Buff). Durch die 1774 uraufgeführten Dramen Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand (2. Fassung) und Clavigo erwarb er sich den Ruf eines führenden Mitglieds der Opposition gegen das bestehende Theater. Seine Dichtung steigerte sich zur freien expressiven Form der Hymnen (Prometheus, Ganymed). 1774 löste der Briefroman Die Leiden des jungen Werthers das „Werther-Fieber“ eines mit Lebensüberdruss gepaarten Protests gegen das Philistertum aus. Vorübergehend mit der Frankfurter Bankierstochter „Lili“ Schönemann verlobt, nahm Goethe im Oktober 1775 nach einer Schweizreise (in Zürich bei Bodmer und Johann Caspar Lavater, dessen Schrift Von der Physiognomik 1772 erschienen war) die Einladung des durch seine Volljährigkeit zur Regierung gelangten Karl August (1757–1828), Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, an den Hof in Weimar an.
Als (1782 geadelter) Minister leitete Goethe in Weimar die Finanzen, das Bergbau- und das Militärwesen, später auch das Theater- und Bildungswesen; zugleich diente er dem ungestümen Herzog als Gefährte („Geniereise“ in die Schweiz 1779). Zum „Musenhof“ der Herzoginmutter Anna Amalia gehörten Herder und Wieland. Leidenschaftliche Zuneigung verband Goethe mit der verheirateten Freifrau Charlotte von Stein (1742–1827). Zu den literarischen Werken, die er nach Weimar mitbrachte, gehörten der „Urfaust“ und eine erste Fassung des Egmont; als neue Arbeiten entstanden die ersten Fassungen des Wilhelm-Meister-Romans sowie der Dramen Iphigenie auf Tauris (U 1779) und Torquato Tasso. Zu den naturwissenschaftlichen Studien gehörte die Entdeckung des menschlichen Zwischenkieferknochens.
Den Weimarer Verhältnissen entzog sich Goethe im Herbst 1786 durch eine in Karlsbad fluchtartig angetretene Reise nach Italien (Hauptaufenthalt Rom, Reise nach Neapel und Sizilien), von der er Mitte 1788 zurückkehrte. In Italien fand Goethe das Erlebnis der Antike und einer sich in Natur und Gesellschaft frei entfaltenden Sinnlichkeit; sie sind Themen der Römischen Elegien (E 1788–90, 1. Titel Erotica Romana), die zugleich den Beginn der Lebensgemeinschaft mit Christiane Vulpius spiegeln (1789 Geburt des Sohns August, Trauung 1806). Die Entstehung der neuen Konzeption der „Klassik“ bezeugen die in Italien entstandenen Neufassungen der Weimarer Dramen; kennzeichnend für Goethes organische Auffassung aller Naturphänomene ist die 1788 entwickelte Idee einer „Urpflanze“. 1787–90 erschien die erste autorisierte Werkausgabe (8 Bde.), darin enthalten Faust. Ein Fragment (1790). Einen zweiten Italienaufenthalt brachte 1790 eine Reise nach Venedig (Beginn der Auseinandersetzung mit der Frz. Revolution in den Venetianischen Epigrammen). 1791 übernahm Goethe die Leitung des Weimarer Hoftheaters (bis 1817), im 1. Koalitionskrieg gegen die frz. Republik gehörte er zur Begleitung des in preuß. Dienst kämpfenden Herzogs (1792 Kanonade von Valmy, 1793 Rückeroberung von Mainz).
Goethes enge Verbindung mit Schiller von 1794 bis zu dessen Tod 1805 bildete den produktiven Mittelpunkt der „Weimarer Klassik“: Zusammenarbeit an Schillers „Horen“ und „Musenalmanach“ (darin 1797 die zeit- und literaturkritischen Xenien, 1798 „Balladenalmanach“) sowie an Goethes Kunstzeitschrift „Propyläen“ (1798–1800, Beginn der Beziehung zum Verlag Cotta), literaturtheoretische Erörterungen (Gattungsgesetze der Epik und Dramatik), gemeinsame Theaterarbeit. Unter Schillers kritischer Anteilnahme kam Wilhelm Meisters Lehrjahre zum Abschluss (V 1795/96), entstand das Versepos Hermann und Dorothea und nahm Goethe sein Faust-Drama wieder in Arbeit (Faust. Der Tragödie erster Teil, V 1808; Beginn der Arbeit an Faust, II. Teil um 1800, V posthum 1833). Goethes wissenschaftliche Tätigkeit war vor allem der Widerlegung der mechanistischen Erklärung der Licht- und Farberscheinungen durch Newton gewidmet (Zur Farbenlehre, 2 Bde. 1810).
Zunehmende Bedeutung gewann die Auseinandersetzung mit der Literatur- und Geschichtsauffassung sowie Naturphilosophie der Romantiker (A. W. Schlegel, F.Schlegel, Schelling, 1807 Beginn des Umgangs mit B. v. Arnim). Sie spiegelt sich u. a. in dem Eheroman Die Wahlverwandtschaften. 1814 und 1815 reiste Goethe ins Rhein-Main-Gebiet; in Wiesbaden lernte er Marianne von Willemer kennen, die „Suleika“ des unter dem Eindruck pers. Dichtung entstandenen West-östlichen Divan (V 1819). Die Slg. steht im Zusammenhang der von Goethe entwickelten Vorstellung einer sich heranbildenden „Weltliteratur“. Zum Alterswerk gehören die mit Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit (V ab 1811) begonnenen autobiografischen Schriften, der Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden (vollständig 1829), die „Wundersprüche über Menschenschicksale“ Urworte. Orphisch (1820) und die nach dem Tod des Herzogs 1828 entstandenen Dornburger Gedichte, aber auch die Trilogie der Leidenschaft mit der Marienbader Elegie, veranlasst durch die Abweisung der Werbung um die 19-jährige Ulrike von Levetzow im Sommer 1823. Zähmung der Leidenschaft durch Kunst ist das Thema der Erzählung Novelle (V 1828, in diesem Zusammenhang Definition der Gattung Novelle als „ereignete, unerhörte Begebenheit“). Goethes lebenslange Beschäftigung mit der bildenden Kunst dokumentieren seine Beiträge in der 1816–32 hg. Zeitschrift „Über Kunst und Altertum“. Goethes letzter Sekretär (ab 1823) war Johann Peter Eckermann (Gespräche mit Goethe, 1836–48).
Gedichtbände und Zyklen: Neue Lieder (1769), Hymnen (E ab 1772, V teilweise 1775 in „Iris“), Gedichte (1789, Bd. 8 von Goethes Schriften), Römische Elegien (E 1788–90, V 1795), Venetianische Epigramme (E ab 1790, V 1796), Xenien (1797), Balladen (1798 in Schillers „Musenalmanach für das Jahr 1798“, u. a. Der Schatzgräber, Der Zauberlehrling, Die Braut von Korinth, Der Gott und die Bajadere; 1782 erschien Der Erlkönig), Gedichte (1800, Bd. 7 von Goethes neue Schriften), Gedichte (1806, Bd. 1 von Goethes Werke), Gedichte (1815, Bd. 1 und 2 von Goethes Werke; darin Sonette, E 1807/08), West-östlicher Divan (E ab 1814, V 1819, erweiterte Fassung 1827), Urworte. Orphisch (1820), Gedichte (1827, Bd. 1–4 von Goethes Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand; darin Trilogie der Leidenschaft, E ab 1823), Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten (1830). – Epen: Reineke Fuchs (1794), Hermann und Dorothea (1797), Achilleis (Fragment, E 1797–99, V 1808). – Erzählungen: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten (1795, darin Das Märchen), Novelle (1. Plan 1797, E 1826/27, V 1828). – Dramen: Stella. Ein Schauspiel für Liebende (1776; 2. Fassung U 1806, V 1816), Der Groß-Cophta (U 1791, V 1792), Der Bürgergeneral (1793), Die natürliche Tochter (U 1803, V 1804). – Schriften zur Kunst: Von deutscher Baukunst. D. M. Ervini a Steinbach (1772), Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil (1789), Über Laokoon (1798), Von deutscher Baukunst (1823). – Schriften zur Literatur: Zum Shakespeares-Tag (E 1771, V 1854), Literarischer Sansculottismus (1795), Über epische und dramatische Dichtung (E 1797, V 1827), Shakespeare und kein Ende (Teil I und II, E 1813, V 1815, Teil III, E 1816, V 1826), Nachlese zu Aristoteles’ Poetik (V 1827). – Schriften zur Naturwissenschaft: Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären (1790), Beiträge zur Optik (2 Bde. 1791/92), Sammlung zur Kenntnis der Gebirge in und um Karlsbad (1807), Zur Farbenlehre (1. Bd. 1808), Zur Farbenlehre (2 Bde. 1810, Tafelband 1812), Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie (2 Bde. 1817–24). – Autobiografisches: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit (3 Bde. V 1811–1814, Bd. 4 E 1816–1831, V posthum 1833), Kunstschätze am Rhein, Main und Neckar (1816), Italienische Reise (1816/17, erweiterte Fassung 1829), Campagne in Frankreich 1792 und Belagerung von Mainz 1793 (1822), Tages- und Jahreshefte (1830).
Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Schauspiel in 5 Akten, E 1773, V 1773, U 1774. Der „Urgötz“ Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen Hand, dramatisiert, E 1771, V posthum 1832.
Die Hauptquelle bildete die 1731 veröffentlichte Autobiografie Lebensbeschreibung Herrn Goezens von Berlichingen, zugenannt mit der eisernen Hand des am Bauernkrieg beteiligten Reichsritters Götz (Gottfried) von Berlichingen (1480–1562).
Die Schauplätze der Handlung gliedern sich in zwei Hauptbereiche: die Burg Jagsthausen des Götz von Berlichingen und den Hof des Bischofs von Bamberg. Sie repräsentieren den historischen Gegensatz zwischen freiem Reichsrittertum und der neuen Macht der (weltlichen und geistlichen) Landesfürsten. Höhepunkte der auf die Fehde zwischen Götz und dem Bischof bezogenen Handlung sind die Gefangennahme des in bischöflichem Dienst stehenden Jugendfreundes Adelbert von Weislingen und die Befreiung des gefangenen Götz durch Franz von Sickingen; zum Verhängnis wird Götz die Beteiligung am Bauernkrieg 1525; er stirbt als Gefangener. In diese Grundstruktur des Gegensatzes von Freiheit und Gefangenschaft ist die (fiktive) Gestalt Weislingens dialektisch einbezogen: Als Gefangener des Götz soll er sich von seiner aus der Sicht des Ritters unwürdigen Bindung an den Hof befreien; wieder auf freiem Fuß, fesselt ihn in Bamberg erneut der aus „Weiber-, Fürstengunst und Schmeichelei“ gedrehte Strick. Weislingen lässt sich von der verführerischen Adelheid zum doppelten Treubruch gegenüber Götz und dessen Schwester Maria, mit der er sich verlobt hat, verleiten und wird zum Anführer im Kampf gegen den vom Reich Geächteten. Doch Weislingen bleibt ein bloßes Werkzeug, das sich notfalls beseitigen lässt: Er wird, inzwischen mit Adelheid verheiratet, durch den ihr hörigen Pagen Franz vergiftet; Adelheid selbst fällt der Rache eines Femegerichts zum Opfer. In krassem Gegensatz hierzu umgibt die Sterbeszene des Götz etwas Verklärendes; seine letzten Worte im Gärtchen beim Gefängnisturm sind: „Himmlische Luft. – Freiheit! Freiheit!“
Vom „Urgötz“ unterscheidet sich die 2. Fassung vor allem hinsichtlich des Anteils, den der Themenbereich des Bauernkriegs besitzt. Während der „Urgötz“ Gewicht auch auf die Gründe des Aufstands legt, reduziert die Neufassung die Auftritte des Bauernheers, das den Ritter zur Teilnahme zwingt, und verstärkt hierdurch den Eindruck, als handle es sich bei den Bauern um eine brand- und mordlüsterne Bande. So hat Goethe – wohl um der Profilierung seines Titelhelden willen – die sog. Helfenstein-Szene gestrichen, in der die Frau des gefangenen Otto von Helfenstein vergeblich um dessen Freiheit fleht; Metzler, ein Anführer der Bauern, erinnert in diesem Zusammenhang an eine Schandtat des Adligen: „Er stund der Abscheu wie ein eherner Teufel, stund er und grinste uns an. Verfaulen sollen sie lebendig und verhungern im Turm knirscht er. Damals war kein Gott für uns im Himmel, jetzt soll auch keiner für ihn sein.“
Die revolutionäre Wirkung des Dramas beruhte auf der an Shakespeare geschulten freien Form in Gestalt der hier erstmals radikal durchgeführten Aufhebung der Einheit von Zeit, Ort und Handlung, die sich in mehr als 50 Einzelszenen gliedert. Ein zweites wesentliches Merkmal bildet die Einbeziehung von Repräsentanten sämtlicher Schichten und Institutionen vom Kaiser über den Kaufmann bis hinab zum Köhler und deren realistische Charakterisierung durch ihr jeweiliges Sprachverhalten. Hinzu kam, dass sich zumindest ein Teil der Leserschaft und des Publikums mit der Auflehnung des „Selbsthelfers“ Götz gegen die Fürstenmacht identifizieren konnte. Brennende Aktualität besaßen beispielsweise die Worte des sterbenden Gefangenen: „Es kommen die Zeiten des Betrugs, es ist ihm Freiheit gegeben. Die Nichtswürdigen werden regieren mit List, und der Edle wird in ihre Netze fallen.“
Die Leiden des jungen Werthers. Briefroman in 2 Teilen, V 1774, Neufassung u. d. T. Die Leiden des jungen Werther ab 1782, V 1787, Vert 1891 J. E. F. Massenet, u. a. Frankr. 1938 Max Ophüls, vgl. Plenzdorf.
Das nach Goethes Erinnerung im Februar/März 1774 in vier Wochen niedergeschriebene Werk, „ohne dass ein Schema des Ganzen oder die Behandlung eines Teils irgend vorher wäre zu Papier gebracht gewesen“, besitzt autobiografische Elemente: 1772 befand sich Goethe in Wetzlar in einem „Dreiecksverhältnis“ mit Charlotte Buff und ihrem Verlobten Kestner; bald nach Goethes fluchtartiger Abreise aus Wetzlar nahm sich der Leipziger Studienfreund und ebenfalls in Wetzlar tätige Jurist Karl Wilhelm Jerusalem aus Verzweiflung über seine aussichtslose Liebe zu einer verheirateten Frau das Leben; Anfang 1774 unterband Peter Anton Brentano (der spätere Vater Brentanos und B. v. Arnims) Goethes Freundschaft zu Maximiliane von La Roche, die er soeben geheiratet hatte. Die Motive der Liebe zu einer „gebundenen“ Frau und des Selbstmords angesichts unerfüllbarer Liebe ergeben im Wesentlichen die Handlung des Romans.
Der Text besteht zum Großteil aus Briefen, die Werther an seinen Freund Wilhelm richtet. Hierdurch ist gewährleistet, dass die dargestellte Realität als subjektive Spiegelung in Erscheinung tritt. Im 2. Brief wird diese Erlebnis- und Gestaltungsweise unmittelbar angesprochen: „Ach, könntest du das wieder ausdrücken, könntest du dem Papier das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, dass es würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele der Spiegel des unendlichen Gottes ist!“ Unmittelbar darauf klingt, gleichsam als „Exposition“, das Todesmotiv an: „Aber ich gehe darüber zugrunde, ich erliege unter der Herrlichkeit dieser Erscheinungen.“
Der Spannungsbogen des 1. Teils reicht von der ersten Begegnung mit Lotte, die Werther zu einem Ball begleitet, über den fast täglichen Umgang mit Lotte und ihrem Verlobten Albert, die Verzweiflung über Lottes Unerreichbarkeit bis zu Werthers freiwilligem Entschluss zu weichen. Zu den Höhepunkten des 1. Teils gehört die Auseinandersetzung mit Albert über „Vernunft“ und „Leidenschaft“ sowie über das Recht zum Selbstmord, den Werther als Ausdruck einer „Krankheit zum Tode“ verteidigt.
Der 2. Teil zeigt Werther im Dienst eines Gesandten, dessen Pedanterie ihm viel Verdruss bereitet. Der Schilderung des „glänzenden Elends“ des Hoflebens folgen Episoden, in denen Werther tiefe Kränkungen durch Standesdünkel und die Herabwürdigung seiner Person erfährt. Er nimmt seinen Abschied und kehrt zu Lotte und Albert zurück. Er glaubt zu erkennen, dass die Verlobten in ihren Empfindungen nicht völlig übereinstimmen, und spielt mit der Vorstellung vom Tod Alberts; Werthers Naturschilderungen enthalten Bilder der Zerstörung, an die Stelle Homers tritt Ossian.
Den Schlussteil bildet ein Bericht des Herausgebers, in den die Abschiedsbriefe Werthers an Wilhelm und an Lotte eingefügt sind: Hingerissen von der eigenen Lesung seiner Ossian-Übersetzung, überwältigt Werther die sinnliche Leidenschaft, doch Lotte entzieht sich und verbietet ihm das Haus. Seinen Selbstmord deutet Werther als Opfer für die Geliebte. Durch die (in der Neufassung noch verstärkte) Einbettung der Haupthandlung in korrespondierende Nebenhandlungen wird der exemplarische Charakter unglücklicher Liebe betont. Im Grunde ist jedoch allein schon die bedingungslose Subjektivität Werthers der „objektive“ Ausdruck des Problems der Beschränkung und Erniedrigung des Reichtums an Empfindung, Gefühl und Fantasie.
Dem ungeheuren Erfolg des Romans (mit zahlreichen Parodien) liegt nicht zuletzt die Unmittelbarkeit zugrunde, mit der die Skala von Empfindungen zwischen höchster Wonne und tiefster Verzweiflung ihre sprachliche Gestalt gefunden hat.
Iphigenie auf Tauris. Schauspiel in 5 Akten. 1. Fassung (Prosa) 1779 als vom Weimarer Hof in Auftrag gegebenes Festspiel, U 1779 (mit Goethe in der Rolle des Orest); 2. Fassung (freie Jamben) 1780; 3. Fassung (Prosa) 1781; 4. Fassung (Jamben) 1786, V 1787, U in Schillers Bearbeitung 1802. Goethe stützte sich auf die Tragödie des Euripides (Iphigenie bei den Tauriern, U 414/12 v. Chr.).
Der Schauplatz ist der Hain vor dem Tempel der Diana auf Tauris (= Halbinsel Krim). Das Schauspiel beginnt mit der Bitte Iphigenies an Diana, deren Dienst sie als Priesterin versieht, um die Rückkehr in die Heimat: „(…) Und an dem Ufer steh ich lange Tage,/Das Land der Griechen mit der Seele suchend;/Und gegen meine Seufzer bringt die Welle/Nur dumpfe Töne brausend mir herüber“ (in der Prosafassung von 1779: „[…] denn mein Verlangen steht hinüber nach dem schönen Lande der Griechen, und immer mögt ich übers Meer hinüber das Schicksal meiner Vielgeliebten teilen“). Arkas kündigt die Ankunft des Königs Thoas an, der erneut um die Priesterin werben will. Iphigenie, die bisher ihre Herkunft verschwiegen hat, schildert dem König die Verbrechen ihrer Vorfahren seit Tantalus sowie ihre durch Diana verhinderte Opferung bei der Ausfahrt der Griechen gegen Troja. Thoas spricht von der Gefangennahme zweier Fremder. Es sind dies Iphigenies Bruder Orest und dessen Freund Pylades. Durch diesen erfährt Iphigenie vom Ausgang des Trojanischen Krieges und der Ermordung ihres Vaters Agamemnon, durch Orest von der Ermordung ihrer Mutter Klytämnestra. Orest gibt sich als Bruder und Muttermörder zu erkennen und erkennt in Iphigenie die totgeglaubte Schwester. In ihrem Auftrag, an den beiden Fremden das Menschenopfer vorzunehmen, sieht er die Bestätigung des auf der Familie lastenden Fluchs: „Der Brudermord ist hergebrachte Sitte / Des alten Stammes (…).“ Zugleich ahnt er seine bevorstehende Befreiung von der Verfolgung durch die Erinnyen, und zwar mittels des Raubs des Diana-Kultbilds, den ein Orakelspruch Apollons als Voraussetzung für Orests Entsühnung genannt hat. Iphigenie ist zunächst bereit, an dem von Pylades entwickelten Plan der gemeinsamen Rettung mitzuwirken, enthüllt ihn jedoch nach schwerem innerem Kampf dem König, der seinerseits zur reinen Humanität gelangt, indem er schließlich die Geschwister und Pylades in die Heimat ziehen lässt. Die einzige Bedingung des Thoas, das Diana-Kultbild müsse auf Tauris bleiben, erweist sich als erfüllbar, indem die Orakel-Formulierung „seine Schwester“ nicht auf Apollons Schwester Diana bzw. Artemis, sondern auf Iphigenie als die Schwester des Orest bezogen wird.
Die ausschließliche Deutung des Stücks als Inbegriff des klassischen, in Iphigenie verkörperten Humanitätsideals („Alle menschlichen Gebrechen / sühnet reine Menschlichkeit“) verkennt die skeptischen Töne, die vor allem in der Beziehung zwischen Iphigenie und Thoas anklingen. So antwortet der „barbarische“ Skythenkönig auf Iphigenies im Grunde herablassende Herausforderung „Verdirb uns – wenn du darfst“ mit bitterer Ironie: „Du glaubst, es höre / Der rohe Skythe, der Barbar, die Stimme / Der Wahrheit und der Menschlichkeit, die Atreus / Der Grieche nicht vernahm?“ Theodor W. Adorno geht in seinem Aufsatz „Zum Klassizismus in Goethes Iphigenie“ (1967) auf das „Gefühl einer Ungerechtigkeit“ ein, das daher rührt, „dass Thoas, der Barbar, mehr gibt als die Griechen, die ihm, mit Einverständnis der Dichtung, human überlegen sich dünken“. Thoas „darf, um eine Sprachfigur Goethes anzuwenden, an der höchsten Humanität nicht teilhaben, ist verurteilt, deren Objekt zu bleiben, während er als ihr Subjekt handelte“. Der Verzicht des Thoas auf eine Verbindung mit Iphigenie enthält das Motiv der Entsagung.
In autobiografischer Hinsicht ist Iphigenie als Widerspiegelung der Persönlichkeit Charlotte von Steins zu verstehen.
Torquato Tasso. Schauspiel in 5 Akten, E ab 1780, V 1790, U (in einer gekürzten Bühnenbearbeitung Goethes) 1807.
Während der Arbeit an dem als Prosadrama begonnenen Stück in Italien konnte die 1785 in Rom erschienene Biografie des Dichters Torquato Tasso (1544–1595) von Pierantonio Serassi herangezogen werden. Tassos Hauptwerk „Das befreite Jerusalem“ kannte Goethe von früher Jugend an (Tasso war ein Lieblingsdichter Johann Kaspar Goethes). Den autobiografischen Zusammenhang bildet der Zwiespalt, in den Goethe in Weimar als Künstler und als mit Ämtern und Pflichten überhäufter Hofmann geraten war.
Der Schauplatz ist das Lustschloss Belriguardo des Herzogs von Ferrara, Alfons II. d’Este. Im Park flechten dessen Schwester Leonore und die Gräfin von Scandiano Kränze, mit denen sie die Hermen (Büstenpfeiler) der Dichter Vergil und Ariost schmücken. Ihr Gespräch über Tasso kennzeichnet ihn als „in den Reichen süßer Träume“ schwebenden Künstler, den zugleich „das Wirkliche gewaltig anzuziehn und festzuhalten“ scheint. Tasso übergibt dem Herzog das vollendete Manuskript seines Epos „Das befreite Jerusalem“ und wird von Leonore mit einem jener Kränze gekrönt. Der Hofmann Antonio Montecatino äußert sich herablassend und kränkend über Tasso. Im Dialog mit Leonore schwärmt Tasso von jener „goldnen Zeit“, in der „jedes Tier, durch Berg’ und Täler schweifend, / Zum Menschen sprach: Erlaubt ist, was gefällt“. Die Prinzessin erkennt Tassos Bereitschaft, die ihm gesetzten Grenzen zu überschreiten, und entgegnet: „Noch treffen sich verwandte Herzen an/Und teilen den Genuss der schönen Welt; / Nur in dem Wahlspruch ändert sich, mein Freund, / Ein einzig Wort: Erlaubt ist, was sich ziemt.“ Vergeblich versucht Tasso auf Leonores Bitte hin, die Freundschaft Antonios zu gewinnen; Alfons muss ein Degenduell verhindern und stellt Tasso vorübergehend unter Arrest. Dem Beispiel der „Geduld und Langmut“ anderer Mäzene folgend, bewilligt Alfons Tassos Bitte um Urlaub vom Hof; Tassos Bekenntnis zur Unbedingtheit seines Schaffens begegnet der Herzog mit dem Rat zu ausgleichendem „Genuss des Lebens“. Beim Abschied von Leonore, die ihre unwandelbare Zuneigung zu erkennen gibt, lässt sich Tasso zu einer leidenschaftlichen Umarmung hinreißen – eine sträfliche Übertretung der Standesgrenzen, die der Herzog durch Tassos Verhaftung ahndet. Zurück bleibt Tassos ehemaliger Kontrahent Antonio, auf dessen Mahnung, sich zu fassen, der Dichter mit der Klage antwortet: „Die Träne hat uns die Natur verliehen, / Den Schrei des Schmerzes, wenn der Mann zuletzt / Es nicht mehr trägt – Und mir noch über alles – / Sie ließ im Schmerz mir Melodie und Rede, / Die tiefste Fülle meiner Not zu klagen:/Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, / Gab mir ein Gott, zu sagen, wie ich leide.“
Ähnlich wie Egmont enthält Torquato Tasso unterschiedliche Bezugspunkte: Als „gesteigerter Werther“ übt Tasso in seinem Unglück radikale Kritik an den Schranken der Konvention und an der Verfügung über Menschen („So hat man mich bekränzt, um mich geschmückt/Als Opfertier vor den Altar zu führen!“). Leonore dagegen verkörpert das für die klassische Lebens- und Kunstauffassung kennzeichnende Streben nach den im Besonderen enthaltenen allgemeinen Gesetzmäßigkeiten; es drückt sich in sentenzenhaften Äußerungen aus, etwa: „Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte.“ Auch die durchgehende Verwendung von Blankversen (fünfhebige Jamben ohne Endreim) zielt auf Mäßigung und Bändigung der (im Götz-Drama noch extrem individualisierten) Sprache. Dennoch hat Torquato Tasso gesellschaftskritische Schärfe behalten. Yaak Karsunke hat sie 1969 in seinem Gedicht „simples sonett auf Torquato Tasso: für Bruno Ganz“ (Tasso-Darsteller der Bremer Inszenierung Peter Steins) auf diese Weise betont: „dass der beherrschte sich nicht selbst beherrscht, heißt: schuld.“
Wilhelm Meisters Lehrjahre. E ab 1794, V 1795/96. Als Grundlage diente das Fragment Wilhelm Meisters theatralische Sendung, E 1777–85, V (nach einer wiederentdeckten Abschrift) 1911.
Im Mittelpunkt der fragmentarischen Erstfassung steht Wilhelm als von Jugend an mit dem Theater vertrauter Schriftsteller, der sich zum Theaterdichter und Regisseur entwickelt. Zahlreiche autobiografische Bezüge lassen das Werk als Darstellung von Goethes eigener „theatralischer Sendung“ erscheinen.
Durch die Neufassung hat Goethe den modernen Erziehungs- und Bildungsroman begründet. Die letztere Bezeichnung deutet an, dass diese Ausprägung des Romans das breite Spektrum der im weitesten Sinne „bildenden“ Kräfte einer Zeit zur Darstellung bringt, und zwar anhand der Entwicklung der handelnden Personen. Wilhelm nennt in einem Brief an seinen zukünftigen Schwager eine Voraussetzung, die hierbei bestehen muss, nämlich die Bereitschaft der Protagonisten, sich den Entwicklungsmöglichkeiten zu öffnen: „Mich selbst, ganz wie ich da bin, auszubilden, das war dunkel von Jugend auf mein Wunsch und meine Absicht.“ Allerdings sind Wilhelm Meisters Lehrjahre nichts weniger als eine „soziokulturelle“ Bestandsaufnahme, so reich das Werk an konkreten Zeitbezügen auch ist. Die unerschöpfliche Fülle resultiert aus der romanhaften „Aufhebung“ der Zeitdarstellung durch die Vielfalt der Gestaltungsmittel; sie erzeugen Spannung, bieten Abenteuerliches, lassen manches im Geheimnisvollen, verknüpfen Reflexionen mit Liedern, den programmatischen Disput mit der ironischen Brechung. Die Haupthandlung führt Wilhelm aus dem bürgerlichen Elternhaus über die Mitgliedschaft in einer Theatergruppe bis hin zur „Turmgesellschaft“, die Züge des Freimaurertums aufweist. Daneben zeichnen die Bekenntnisse einer schönen Seele (6. Buch) ein Bild des Pietismus. Irrationale und tragische Aspekte der Kunst verkörpern Mignon und der Harfner.
Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. E ab 1807, 1. Fassung V 1821, 2. Fassung V 1829.
Das nach Goethes eigenem Urteil „wenn nicht aus einem Stück, so doch aus einem Sinne“ geformte Werk schließt insofern an die Lehrjahre an, als Wilhelm im Auftrag der „Turmgesellschaft“ eine ihm von diesem Orden der Entsagenden genau vorgeschriebene Bildungsreise in Mignons Heimat unternimmt.
Das 2. Buch handelt von der „Pädagogischen Provinz“, in der Wilhelm seinen Sohn Felix erziehen lassen will. Die jungen Menschen werden zu den drei Formen der Ehrfurcht angehalten: zur Ehrfurcht vor dem, was über uns, was neben uns und was unter uns ist. „Aus diesen drei Ehrfurchten entspringt die oberste Ehrfurcht, die Ehrfurcht vor sich selbst, und jene entwickeln sich abermals aus dieser, sodass der Mensch zum Höchsten gelangt, (…) ohne durch Dünkel und Selbstheit wieder ins Gemeine gezogen zu werden.“
Zugleich tritt an die Stelle der individuellen Selbstentfaltung die Bindung an die Gemeinschaft: „Narrenpossen sind eure allgemeine Bildung und alle Anstalten dazu. Dass ein Mensch etwas ganz entschieden verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der nächsten Umgebung, darauf kommt es an.“ Hierbei ist Goethes Blick in die Zukunft, auf die sich entwickelnde Industriegesellschaft, gerichtet. Als Summe aller Weisheit nennt Wilhelm „Denken und Tun, Tun und Denken“. Ein schon in den Lehrjahren angesprochenes Thema ist das der Auswanderung nach Amerika, verstanden als ein Land ohne belastende Vergangenheit, in dem das soziale Leben etwa in Form von Arbeitergenossenschaften neue Entwicklungsformen erreichen kann.
Dem in loser Form aus erzählenden Teilen, Briefen, Abhandlungen und aphoristischer Spruchweisheit gestalteten Wilhelm-Meister-Bereich ist ein Zyklus von Novellen eingefügt, u. a. Die neue Melusine und Der Mann von fünfzig Jahren.
Die Wahlverwandtschaften. Roman, E ab 1807, V 1809, Verf DDR 1974 Siegfried Kühn.
Der Titel bezieht sich auf die als „Wahlverwandtschaft“ bezeichnete Fähigkeit chemischer Elemente, eine Verbindung aufzulösen und mit dem frei gewordenen Element eine neue Verbindung einzugehen. Goethes Absicht war es, in einem „sittlichen Falle eine chemische Gleichnisrede zu ihrem geistigen Ursprung zurückzuführen“. Zugrunde liegt die Überzeugung, dass „überall nur eine Natur ist und auch durch das Reich der heiteren Vernunftfreiheit die Spuren trüber, leidenschaftlicher Notwendigkeit sich unaufhaltsam hindurchziehen, die nur durch eine höhere Hand und vielleicht auch nicht in diesem Leben völlig auszulöschen sind“ (Vorankündigung des Romans, 1809).
Die Protagonisten der ins Sittliche gewendeten „chemischen Gleichnisrede“ sind der Baron Eduard und seine Frau Charlotte, ein Hauptmann und die junge Ottilie. Den äußeren Rahmen bildet das Zusammenleben auf Eduards Landgut; man beschäftigt sich mit allerlei Verschönerungsarbeiten im Haus und Landschaftsgarten. Zum Symbol des „geistigen Ehebruchs“, den Eduard mit Ottilie, der Hauptmann mit Charlotte begeht, wird Charlottes Kind, das Züge Ottilies und des Hauptmanns trägt. Eine tragische Wendung nimmt die Handlung, als Charlottes Kind durch die Schuld Ottilies ums Leben kommt; sie stirbt an den Folgen ihres Fastens. Eine Gegenfigur zu Ottilie ist Charlottes Tochter aus erster Ehe, die „luziferische“ Luciane mit einer Vorliebe für Affen. Die unmittelbare Charakterisierung von Personen, zu der auch Ottilies Tagebuch gehört, ist ebenso ein Merkmal der Erzählweise wie ein dichtes Geflecht aus Dingsymbolen.
Entstanden in einer Zeit weit verbreiteter Eheskepsis, ist das von den Romantikern begeistert aufgenommene Werk als der erste moderne Eheroman der dt. Literatur zu betrachten.
Egmont. Trauerspiel in 5 Akten, E 1774–87, V 1788, U 1789, Bühnenbearbeitung Schillers (aus Goethes Sicht „grausam, aber konsequent“) 1796, Beethovens Bühnenmusik 1809/10.
Die Charakterisierung der Titelgestalt hat nur wenig mit dem Grafen Egmont (1522 bis 1568), Statthalter von Flandern und Artois, gemein. Den historischen Zusammenhang der Handlung bildet der Beginn des Freiheitskampfs der Niederlande: Bildersturm, Ablösung der Regentin Margarete von Parma durch Herzog Alba, Adelsopposition unter Wilhelm von Oranien. Der Schauplatz ist Brüssel.
Die drei Szenen des 1. Akts beleuchten Egmont aus der Sicht des Volkes (Leutseligkeit, Toleranz, Wertschätzung des „freien Lebens“), der Regentin (Sorge über Egmonts Popularität) und aus der Sicht Klärchens, der bürgerlichen Geliebten des Grafen: Für sie ist Egmont „nur Mensch, nur Freund, nur Liebster“. Der 2. Akt zeigt Egmont als politischen Menschen, der zwar den Aufruhr dämpft, jedoch die Kritik an der span. Gewaltherrschaft teilt. Den Höhepunkt der politischen Auseinandersetzung bildet der Disput Egmonts mit Alba über die verbürgte Freiheit der Niederlande im 4. Akt; Egmont wird verhaftet. Vergeblich versucht Klärchen, das Volk zum Aufstand zu bewegen; sie nimmt Gift. Im Kerker erscheint sie Egmont als Allegorie der Freiheit und gibt dem zum Tode Verurteilten die Gewissheit, dass der Freiheitskampf der Niederlande siegreich enden wird.
Aufgrund der langen Entstehungszeit des „vertrödelten Stücks“ (Goethe 1781 an Charlotte von Stein) enthält es Elemente aus verschiedenen Entwicklungsstufen im Schaffen Goethes: Mit der Sturm-und-Drang-Gestalt des Götz von Berlichingen teilt Egmont das blinde Vertrauen in die eigenen Rechte; in demselben Zusammenhang steht die beißende Kritik am Absolutismus. Die Darstellung des Adligen Egmont als Anwalt bürgerlicher humaner Freiheit entspricht Goethes frühklassischer Gesellschaftskonzeption.
Lyrik. V ab 1769, Vert Karl Friedrich Zelter (Goethes „Hauskomponist“, u. a. Es war ein König in Thule), Ludwig van Beethoven (Kennst du das Land, Nur wer die Sehnsucht kennt), Franz Schubert (Heidenröslein, An Schwager Kronos, Prometheus, Wandrers Nachtlied, Grenzen der Menschheit, Erlkönig, Suleika-Lieder), Robert Schumann (Wandrers Nachtlied), Johannes Brahms (Harzreise im Winter, Gesang der Parzen für Chor und Orchester), Hugo Wolf (Lieder aus Wilhelm Meister und dem West-östlichen Divan, Balladen), Richard Strauss (Wanderers Sturmlied).
Bei der Herausgabe seiner ersten Werkausgabe (Schriften, 8 Bde., 1787– 90) stellte Goethe die 1784 entstandenen Stanzen Zueignung als Einleitung in das Gesamtwerk an den Beginn des 1. Bandes. Das Gedicht handelt von der Erscheinung eines „göttlichen Weibes“, das dem Dichter eine Gabe überreicht: „Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit“. Dieses Bild kann als Grundzug in Goethes lyrischem Schaffen verstanden werden: Alle im Gedicht erfasste sinnliche und geistige Wahrnehmung verweist auf eine tiefere Bedeutung, ohne sich dualistisch als „vordergründig“ von einem „Hintergrund“ zu trennen. Es gehört zum Wesen der Wahrheit, dass sie nur im „Schleier“ der Dichtung in Erscheinung treten kann. Diese Auffassung liegt insgesamt Goethes Symbolbegriff zugrunde und verbindet die Vielfalt der Themen und Formen seiner Lyrik.
Das erste erhaltene Gedicht hat der 7-jährige Goethe an den „Erhabnen Großpapa!“ und die „Erhabne Großmama!“ gerichtet (Bei dem erfreulichen Anbruche des Jahres 1757). Zehn Jahre später entstand als erste handschriftliche Sammlung das Buch Annette, dessen Lieder der spielerisch-heiteren, pointierten Liebeslyrik der Anakreontik angehören. Aus demselben Jahr stammen aber auch die drei Oden an meinen Freund (veranlasst durch den erzwungenen Abschied Ernst Wolfgang Behrischs aus Leipzig), in denen sich die Verse finden: „Gebärort / Schädlicher Insekten, / Mörderhülle/Ihrer Bosheit“. Das Grundthema der Betroffenheit durch die Erscheinungen der Natur schlägt das Lied Maifest mit der Durchbrechung des metrischen Schemas (Auftakt kurz-lang) im 2. Vers der 1. Strophe an: „Wie herrlich leuchtet/ Mir die Natur!“ Es steht im Zusammenhang der sog. Sesenheimer Lieder (1770/71), zugleich entstanden volksliedhafte Gedichte (Heidenröslein, von Herder als authentisches Volkslied veröffentlicht).
Ab 1772 folgte Goethe mit der Verwendung freier Rhythmen dem Vorbild Klopstocks (Hymnen der „Geniezeit“ des Sturm und Drang: Wandrers Sturmlied, Mahomets-Gesang, Prometheus, Ganymed, An Schwager Kronos, Harzreise im Winter). Vor der Übersiedlung nach Weimar richtete Goethe Lieder an die Verlobte Lili Schönemann.
Die Spannweite des lyrischen Schaffens der ersten Weimarer Jahre reicht vom geselligen Gelegenheitsgedicht über die an Charlotte von Stein gerichteten Liebesgedichte bis zur Natur- und Weltanschauungslyrik (An den Mond, Wandrers Nachtlied, Gesang der Geister über den Wassern, Grenzen der Menschheit, Das Göttliche). Dem Vorbild der Antike (Tibull, Properz, Ovid) folgen die Römischen Elegien (1788 bis 1790); ihr zentrales Thema ist Rom als Stadt der Antike und erfüllter Liebe: „Froh empfind’ ich mich nun auf klassischem Boden begeistert,/Vor- und Mitwelt spricht lauter und reizender mir“ (V. Elegie). In stofflicher und formaler Hinsicht machte sich Goethe zunehmend fremde Anregungen in schöpferischer Neugestaltung zu Eigen: Die 1797 im Wettstreit mit Schiller entstandenen Balladen verarbeiten z. T. antike Stoffe, die Sonette (1807/08) zeigen den Einfluss der Romantik, der West-östliche Divan (ab 1814, V 1819) ist unter dem Eindruck pers. Dichtung entstanden (Beginn der Rezeption der orientalischen Lyrik in Dtl.). Die Vielfalt des lyrischen Schaffens gipfelt in Goethes letztem Drama, dem zweiten Teil der Faust-Dichtung.
Faust. Der Tragödie erster Teil. E der 3. Fassung ab 1797, V 1808 (Faust. Eine Tragödie), U von Einzelszenen 1819, vollständig 1829, Vert Hector Berlioz Acht Szenen aus Goethes Faust 1829 (Endfassung Fausts Verdammnis 1846), Richard Wagner Faust-Ouvertüre 1840, Franz Liszt Faust-Sinfonie 1857, Charles Gounod Faust bzw. Margarete 1859, Verf Dtl. 1926 Faust. Eine deutsche Volkssage F. W. Murnau, B. D. 1960 als Aufzeichnung der Hamburger Inszenierung von Gustaf Gründgens. Vorstufen: Urfaust, E 1772–75, V (nach einer 1887 wiederentdeckten Abschrift) 1887; Faust. Ein Fragment, V 1790.
Zu den Quellen gehören das Volksbuch „Historia von D. Johann Fausten“ (V 1587) über den historischen Johannes bzw. Georg Faust (um 1480 bis um 1540), das Goethe vermutlich in einer der späteren Bearbeitungen kennen gelernt hat, und die Puppenspiele, denen die erste Dramatisierung des Stoffes durch Christopher Marlowe „The tragical history of Doctor Faustus“ (E um 1589, V 1604) zugrunde liegt. Bekannt war Goethe auch Lessings Faust-Fragment (erstmals Möglichkeit der Rettung Fausts). Schon im „Urfaust“ verband Goethe die „Gelehrtentragödie“ mit der „Gretchentragödie“, veranlasst durch die Hinrichtung der Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt 1772 in Frankfurt (Akten über den Prozess befanden sich im Besitz Johann Kaspar Goethes). Faust. Ein Fragment bricht nach der Domszene ab, enthält also nicht den Abschluss der „Gretchentragödie“ (Kerkerszene); neu ist gegenüber dem „Urfaust“ die 1788 in Italien entstandene Szene Hexenküche (Fausts Verjüngung). In beiden Vorstufen fehlen noch der Osterspaziergang, Fausts erste Begegnung mit dem in Gestalt eines Pudels in Fausts Studierstube gelangten Mephisto und die Walpurgisnacht.
Faust I besitzt drei Prologe: Zueignung (Reflexionen des Autors über die Beziehung zu seinen Dramengestalten), Vorspiel auf dem Theater (Gespräch zwischen Dichter, Theaterdirektor und Lustiger Person über das Verhältnis zwischen Theaterdichtung und deren publikumswirksamer Darbietung) und Prolog im Himmel (Wette zwischen dem „Herrn“ und Mephisto: Die Seele Fausts soll dem Teufel gehören, wenn es diesem gelingt, den Gelehrten vom „richtigen Weg“ abzubringen).
Der Eingangsmonolog zeigt Faust in seiner Qual angesichts der Begrenztheit menschlicher Erkenntnis; verborgen bleibt ihm trotz aller Kenntnisse, „was die Welt/Im Innersten zusammenhält“. Die Hinwendung zur Magie in der Form naturphilosophisch-alchimistischer Weltdeutung bringt Begeisterung und Ernüchterung: „Welch Schauspiel! Aber ach! ein Schauspiel nur!“ Angesichts der Erscheinung des Erdgeistes wird Faust zum „furchtsam weggekrümmten Wurm“. Dem Dialog mit dem pedantischen Famulus Wagner folgt Fausts Selbstmordversuch, den Glocken und Gesänge des Ostermorgens verhindern.
Fausts Pakt mit Mephisto enthält die Bedingung: Sollte er jemals einen Augenblick der Zufriedenheit erleben, gehört seine Seele dem Teufel. Die anschließende Schülerszene verzerrt die Gelehrtentragödie zur Wissenschaftskomödie. Dem Spuk in Auerbachs Keller folgen Fausts Verjüngung und der Anblick Helenas in einem Zauberspiegel; Faust verlangt ihren leibhaftigen Besitz. In rascher Szenenfolge entwickelt sich nun die „Gretchentragödie“: erste Begegnung, wechselseitige Zuneigung, Liebesnacht, Verbrechen: Gretchens Mutter ist an dem ihr eingegebenen Schlafpulver gestorben, Faust tötet ihren Bruder Valentin, das verlassene Gretchen tötet ihr Kind und verfällt in Wahnsinn; Fausts Versuch, sie aus dem Kerker zu befreien, misslingt. Eingefügt ist die gespenstische Walpurgisnacht, in der Faust Gretchen in Gestalt der Medusa mit abgeschlagenem Haupt erblickt. Faust erlebt sich als „Unmensch ohne Zweck und Ruh“. Mephistos Urteil über Gretchen („Sie ist gerichtet!“) hebt eine „Stimme von oben“ auf: „Ist gerettet!“
Faust. Der Tragödie zweiter Teil. Drama in 5 Akten, E um 1800–31, Teil-V Helena, klassisch-romantische Phantasmagorie. Zwischenspiel zu Faust (3. Akt von Faust II) 1827, Szenen am Kaiserhof (Teile des 1. Akts von Faust II) 1828, vollständig posthum 1833 (1. Band der Nachgelassenen Werke), U 1854, erste gemeinsame Inszenierung beider Teile (in der Bearbeitung von Otto Devrient) 1876, alljährliche Aufführung von Faust I und II am anthroposophischen Goetheanum in Dornach (Schweiz).
Faust wird in den Schlaf des Vergessens gesungen. Erwachend beobachtet er den Übergang von der Dämmerung zum Aufgang der Sonne, deren blendende Helle (Sinnbild des Göttlichen) ihn belehrt: „Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.“ Nicht Unmittelbarkeit der (Gottes-, Natur-) Erkenntnis, sondern die Hinwendung zu den Phänomenen bildet für Fausts Streben das neue Ziel.
„Wir sehn die kleine, dann die große Welt“ – mit diesen Worten hat in Faust I der gemeinsame Aufbruch mit Mephisto begonnen. Der „kleinen Welt“ der mittelalterlichen Stadt als Schauplatz der „Gretchentragödie“ folgt nun die „große Welt“ der Kaiserpfalz. Der Kaiser erhält Bericht über die erbärmliche Lage des Reiches; Mephisto verweist auf Schätze, die „im Boden“ liegen. In einem ausgelassenen Mummenschanz wird der Zerfall der höfischen Gesellschaft dargestellt; Faust tritt in der Kostümierung als Plutus (Gott des Reichtums) auf und demonstriert die Allmacht des Goldes; als Fausts Gegenspieler erfindet Mephisto Papiergeld (Sinnbild des Übergangs zur modernen Wirtschaftsform). Im Auftrag des Hofes sollen Mephisto und Faust Paris und Helena heraufbeschwören; Faust wagt den Gang zu den „Müttern“. Das Wunderspiel gelingt, doch als Faust Helena ergreifen will, beendet eine Explosion die Szene.
Der 2. Akt zeigt den Famulus Wagner, der während Fausts Abwesenheit erstaunliche Fortschritte gemacht hat: Soeben entsteht in seinem Laboratorium das künstliche „Menschlein“ Homunculus. Dieser vermag, Fausts Traum von der Begegnung Ledas mit dem Schwan, d. h. von der Zeugung Helenas, mitzuerleben, und erkennt Fausts Sehnsucht nach der antiken Welt. Geführt von Homunculus nehmen Faust und Mephisto an der Klassischen Walpurgisnacht teil.
Der 3. Akt vereinigt Faust und Helena; ihr Sohn Euphorion (eine Huldigung Goethes an den philhellenischen Dichter Lord Byron) stürzt gleich Ikarus zu Tode; auch Helenas „Körperliches“ entschwindet, ihr Gewand löst sich in Wolken auf, die Faust umgeben und in die Höhe tragen.
Der 4. und 5. Akt zeigen Faust und Mephisto als Kriegshelden und bei der Landgewinnung. Faust wird schuldig, indem er duldet, dass die Hütte von Philemon und Baucis seinen Plänen zum Opfer fällt. Der erblindete Faust hat die Vision der durch seine Kultivierungsarbeit für Millionen eröffneten Räume: „Solch ein Gewimmel möcht’ ich sehn, / Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn! / Zum Augenblicke dürft’ ich sagen: ‚Verweile doch, du bist so schön! (…).‘“ Damit hat Mephisto formal das Anrecht auf Fausts Seele gewonnen, doch muss er nun erfahren: „Herkömmliche Gewohnheit, altes Recht ,/ Man kann auf gar nichts mehr vertrauen!“ Die Faust-Gestalt ist dem mittelalterlichen Teufels- und Höllenwesen entwachsen; die Mephisto narrenden Engel erheben sich schließlich, „Faustens Unsterbliches entführend“.
Goethe sah voraus, dass seine Faust-Dichtung „ein offenes Rätsel bleibe, die Menschen fort und fort ergötze und ihnen zu schaffen mache“ (an Zelter, 1831). Diese Offenheit gewährleistet nicht zuletzt die in Faust II unerschöpfliche Vielfalt der Motive, Bezüge und Gestaltungsformen (allein schon in metrischer Hinsicht); sie bietet im Grunde zu jeder Interpretation auch deren gegenteilige Verständnismöglichkeit und relativiert Maximen wie die viel zitierte, als Zitat in den Text eingefügte „Quintessenz“: „‚Wer immer strebend sich bemüht, / Den können wir erlösen.‘“
Sie finden hier online folgende Texte von Johann Wolfgang (von) Goethe:
Quelle: Ernst Klett Verlag GmbH
Ort: Stuttgart
Quellendatum: 2009
Ort: Stuttgart
Quellendatum: 2009