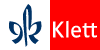Lexikon
Büchner, Georg
Drucken* 17. 10. 1813 in Goddelau (= Riedstadt) bei Darmstadt
† 19. 2. 1837 in Zürich
Die neuere Geschichte der dt. Exilliteratur beginnt mit Georg Büchner. Autoren wie Börne und Heine hatten das restaurative Dtl. mehr oder weniger freiwillig verlassen, Büchner jedoch war, als er nach Frankr. floh, politisch verfolgt; ein am 13. Juni 1835 datierter Steckbrief bezichtigte ihn der „Teilnahme an staatsverräterischen Handlungen“. Nach seinem Tod vergingen mehr als 50 Jahre, bis eine Gesamtausgabe seiner Werke erschien, und erst zu Beginn des 20. Jh.s, zur Zeit des Naturalismus und des Expressionismus, gewann das Schaffen des Dramatikers und Erzählers seine nun allerdings unauslöschliche Wirkung.
Der Sohn eines Amtsarztes wuchs in Darmstadt auf. Hier erhielt er seine Schulausbildung in einer Privatschule und ab 1825 im Gymnasium. 1831 begann er in Straßburg mit einem Medizinstudium; er wohnte bei dem Pfarrer Jaeglé, mit dessen Tochter Wilhelmine (Minna) er sich 1833 verlobte. Die politische Haltung des knapp 20-Jährigen zeigt ein Brief an die Eltern, in dem er nach dem „Frankfurter Putsch“ (3. 4. 1833) schreibt: „Was nennt Ihr den gesetzlichen Zustand? Ein Gesetz, das die große Masse der Staatsbürger zum fronenden Vieh macht, um die unnatürlichen Bedürfnisse einer unbedeutenden und verdorbenen Minderzahl zu befriedigen? Und dies Gesetz, unterstützt durch eine rohe Militärgewalt und durch die dumme Pfiffigkeit seiner Agenten, ist eine ewige, rohe Gewalt, angetan dem Recht und der gesunden Vernunft, und ich werde mit Mund und Hand dagegen kämpfen, wo ich kann.“
Im Herbst 1833 setzte Büchner sein Studium in Gießen fort. Hier trat er mit den „Oberhess. Verschwörern“ um den Butzbacher Schulrektor Weidig in Verbindung, gründete in Gießen und später auch in Darmstadt eine geheime „Gesellschaft der Menschenrechte“ und verfasste die (von Weidig redigierte und ergänzte) Flugschrift Der Hessische Landbote (Druck Juli 1834), die unter dem Motto „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ mit statistischen Angaben die Unterdrückung und Ausbeutung des Volkes belegt. Denunziation führte zu Verhaftungen im Freundeskreis; Büchner selbst wurde Anfang 1835 verhört. In dieser Zeit entstand das Drama Dantons Tod. Anfang März entging Büchner der Verhaftung durch die Flucht nach Straßburg. 1836 weckte er durch einen Vortrag über das Nervensystem der Fische, den die Straßburger „Gesellschaft für Naturwissenschaft“ publizierte, die Aufmerksamkeit des in Zürich lehrenden Naturforschers Oken. Aufgrund seiner Dissertation Über die Schädelnerven der Barben promovierte ihn die Universität Zürich zum Dr. phil. An einem Wettbewerb des Cotta-Verlags beteiligte sich Büchner mit Leonce und Lena. Im Oktober 1836 zog Büchner nach Zürich und nahm seine Tätigkeit als Privatdozent auf. Zugleich begann er mit der Arbeit an Woyzeck. Im Alter von 23 Jahren erlag er einer Typhuserkrankung.
1922 stiftete der Volksstaat Hessen den Georg-Büchner-Preis für hess. Künstler (verliehen 1923–32 und 1945–50); er wird seit 1951 durch die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung bundesweit vergeben.
Dantons Tod. Drama in 4 Akten, E und V (in der Bearbeitung Gutzkows und mit dem Untertitel „Dramatische Bilder aus Frankreichs Schreckensherrschaft“) 1835, U 1902.
Dem nach Büchners Angaben „in höchstens fünf Wochen“ verfassten Stück liegen die Darstellungen der Frz. Revolution von Mignet und Thiers sowie die populäre Slg. Unsere Zeit zugrunde. Aus allen drei Werken hat Büchner Passagen übernommen.
Das Bühnengeschehen reicht vom 24. 3. bis zum 5. 4. 1794 (Hinrichtung Dantons und seiner Freunde). Rückerinnerungen (etwa an Dantons Tätigkeit als Justizminister und seine Verantwortung für die Ermordung von mehr als 1000 Gefangenen im September 1792) und die Vorausdeutung auf die Hinrichtung Robespierres (28. 7. 1794) ergeben ein Bild der jakobinischen Phase der Revolution.
Die Handlung gliedert sich in die Konfrontation zwischen Danton, der sich aus der Politik zurückgezogen hat und seinem Hang zum Wohlleben frönt, und Robespierre, dem sittenstrengen „Hüter“ der Revolution (1. Akt), die Ereignisse um die Verhaftung Dantons (Warnungen, Verzicht auf Rettung durch Flucht), die Robespierre in einer Rede vor dem Nationalkonvent rechtfertigt (2. Akt), den Kampf gegen das Terrorregime, den Danton als Angeklagter vor dem Revolutionstribunal aufnimmt, und die erfolgreichen Gegenmaßnahmen seiner Gegner (3. Akt), schließlich die Vorbereitung Dantons und seiner Freunde im Gefängnis auf den Tod (4. Akt). Eingeflochten ist die Geschichte von Dantons Frau Julia, die sich das Leben nimmt, und Desmoulins’ Frau Lucile, die im Wahnsinn endet.
Entscheidend für die dramatische Struktur und die inhaltliche Aussage ist jedoch nicht der Zusammenprall zweier durch Einzelgestalten und ihre Anhänger verkörperter politischer Auffassungen und Verhaltensweisen, sondern das Volk, das in Szenen von bisher unbekannter Ausdruckskraft in Erscheinung tritt. Zwar trifft Robespierres Analyse zu: „Die soziale Revolution ist noch nicht fertig; wer eine Revolution zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab.“ Seine Folgerung („Das Laster muss bestraft werden, die Tugend muss durch den Schrecken herrschen“) kann Danton leicht als Dogmatismus entlarven bzw. als Ausdruck individueller Bedürfnisse: „Es gibt nur Epikureer, und zwar grobe und feine, Christus war der feinste; das ist der einzige Unterschied, den ich zwischen den Menschen herausbringen kann. Jeder handelt seiner Natur gemäß, d. h. er tut, was ihm wohltut.“ Doch beide Protagonisten des politischen Kampfes verfehlen die Realität des Volkes, in dem das Bewusstsein lebt: „Unser Leben ist der Mord durch Arbeit; wir hängen sechzig Jahre lang am Strick und zappeln, aber wir werden uns losschneiden.“ Die realistischen Volksszenen entlarven sowohl Robespierres Programm einer Schreckensherrschaft der Tugend als auch Dantons Epikureismus als Ideologien, die mit den Bedürfnissen des Volkes nichts zu tun haben.
Vielfach wurde der Interpretation des Dramas ein Ende 1833 (d. h. vor Beginn der revolutionären Tätigkeit Büchners) an die Braut gerichteter Brief zugrunde gelegt, in dem es heißt: „Ich studierte die Geschichte der Revolution. Ich fühlte mich wie zernichtet unter dem grässlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, allen und keinem verliehen.“ Es sind dies Überzeugungen, die im Stück zwar gleichfalls artikuliert werden, jedoch klar den Antagonisten Danton und Robespierre zugeordnet sind. Nicht die Revolution, sondern ihre Akteure sind zum Scheitern verurteilt. Damit steht im Einklang, dass die Szenen, die Danton und seine Freunde im Gefängnis zeigen, von erschütternder Expressivität geprägt sind und im Bekenntnis zum Nihilismus gipfeln: „Die Welt ist das Chaos. Das Nichts ist der zu gebärende Weltgott“ (Danton).
Leonce und Lena. Lustspiel in 3 Akten, E 1836, V 1838, U 1885.
Büchner beteiligte sich mit diesem Stück an einem Wettbewerb des Cotta-Verlags um „das beste ein- oder zweiaktige Lustspiel in Prosa oder Versen“; es traf jedoch zu spät ein und blieb unberücksichtigt. Zu den Vorbildern gehören neben Shakespeares Komödien die Lustspiele Ponce de Leon von Brentano und Prinz Zerbino von Tieck.
Prinz Leonce von Popo leidet an grenzenloser Langeweile. Um der Ehe mit Prinzessin Lena von Pipi zu entgehen, bricht er mit seinem Freund Valerio nach Italien auf. Nachdem sie innerhalb eines halben Tages bereits „ein halbes Dutzend Großherzogtümer“ und „ein paar Königreiche“ durchquert haben, treffen sie auf die ihnen unbekannte Lena, die mit ihrer Gouvernante ebenfalls vor der bevorstehenden Hochzeit geflohen ist. Leonce verliebt sich in sie und will, da er in diesem Augenblick sein „ganzes Sein“ erfahren hat, Selbstmord begehen, doch hält ihn Valerio von solcher „Leutnantsromantik“ ab. Leonce und Lena wollen heiraten. Als Automaten verkleidet treffen sie im Schloss des Königreichs Popo ein, wo die Hochzeitsvorbereitungen in vollem Gange sind (der Schulmeister zu den als Ehrenspalier angetretenen Bauern: „Erkennt, was man für euch tut: man hat euch grade so gestellt, dass der Wind von der Küche über euch geht und ihr auch einmal in eurem Leben einen Braten riecht“). Die Unbekannten werden „ineffigie“ getraut und erkennen erst jetzt, dass alles so gekommen ist, wie es geplant war. König Peter dankt ab; mit seinem Staatsminister Valerio, der alle Arbeit unter Strafe stellt, wird Leonce ein Reich ohne Uhren, Kalender und Winterkälte errichten. Das Stück bildet ebenso eine Satire auf das feudalistische System bzw. die Scheinwelt der Duodezstaaten wie auf die Romantik und deren Italiensehnsucht. Die allumfassende Langeweile ist das Merkmal einer überlebten Gesellschaft.
Lenz. Erzählung, E 1835, V 1838, Verf 1970 B. D. George Moorse.
Die Titelgestalt ist der Dichter J. M. R. Lenz. Büchner hat dessen Briefe und die Tagebuchaufzeichnungen des Pfarrers Oberlin benutzt, in dessen Obhut im Elsass Lenz vom 20. 1. bis 8. 2. 1778 war.
Die Erzählung verfolgt die Ereignisse dieser wenigen Tage protokollartig, jedoch in einer sprachlichen Form, die der Erlebnisweise des vom Wahnsinn bedrohten Dichters unmittelbar Ausdruck verleiht. So heißt es in der Schilderung der Wanderung nach Waldbach: „Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte (…) er wühlte sich in das All hinein, es war eine Lust, die ihm wehe tat; oder er stand still und legte das Haupt ins Moos und schloss die Augen halb, und dann zog es weit von ihm, die Erde wich unter ihm, sie wurde klein wie ein wandelnder Stern.“
Der Beruhigung, die zunächst im Waldbacher Pfarrhaus eintritt, folgen Anfälle von Selbstkasteiung und Selbstmordversuche, dann das „süße Gefühl unendlichen Wohls“, als er eine Predigt halten darf, dann wieder das Bewusstsein der völligen Vereinsamung in einer von Hoffnungslosigkeit erfüllten Welt: „Das All war für ihn in Wunden; er fühlte tiefen, unnennbaren Schmerz davon.“ Der Zusammenbruch wird durch den Tod eines Kindes ausgelöst, das Lenz wieder zum Leben erwecken will; die Erfahrung seiner Ohnmacht treibt ihn zur Gotteslästerung: „Es war ihm, als könnte er (…) die Welt mit Zähnen zermalmen und sie dem Schöpfer ins Gesicht speien.“ In die Darstellung einer sich selbst und der Welt zunehmend entfremdeten Psyche ist, in Form eines Kunstgesprächs, ein Bekenntnis zum Leben eingefügt. Hier verurteilt Lenz (und mit ihm Büchner) den Idealismus als „schmählichste Verachtung der menschlichen Natur“: „Ich verlange in allem – Leben, Möglichkeit des Daseins, und dann ist’s gut; wir haben dann nicht zu fragen, ob es schön, ob es hässlich ist.“
Woyzeck. Drama, E 1836/37, V 1879 u. d. T. Wozzeck. Ein Trauerspiel-Fragment, U 1913, Vert 1913 u. d. T. Wozzeck Alban Berg (U 1925), Verf u. d. T. Der Fall Wozzeck DDR 1947 Georg C. Klaren, B. D. 1979 Werner Herzog, u. d. T. Wodzeck B. D. 1984 Oliver Herbrich.
Zugrunde liegt eine Begebenheit, deren medizinisch-psychologische Erörterung Büchner vermutlich durch „Henkes Zeitschrift für Staatsarzneikunde“ kannte, die sein Vater abonniert hatte. 1821 erstach in Leipzig der Perückenmacher und Gelegenheitsarbeiter Johann Christian Woyzeck aus Eifersucht seine Geliebte. Ein Gutachten des Gerichtsmediziners Dr. Clarus erklärte ihn für voll zurechnungsfähig. Obwohl sich Zeugen für Anzeichen einer Geisteskrankheit Woyzecks fanden, wurde die Erstellung eines Gegengutachtens abgelehnt. Die öffentliche Hinrichtung fand 1824 statt.
Die vier Handschriften lassen keine eindeutige Entscheidung über die geplante Reihenfolge der Szenen und den vorgesehenen Schluss zu. So deutet etwa ein mit „Gerichtsdiener. Barbier. Arzt. Richter“ überschriebenes Szenenfragment an, dass das Stück ursprünglich mit der Gerichtsverhandlung enden sollte.
Entsprechend den Handschriften H 2 und H 4 stellen die neueren Ausgaben eine Szene an den Anfang, in der Woyzecks Angstzustände zum Ausdruck kommen. Es folgt ein Dialog mit dem Hauptmann, den Woyzeck rasiert, über Moral und Tugend. Durch den an ihrem Fenster vorbeiziehenden Zapfenstreich bekommt Marie einen imposanten Tambourmajor zu Gesicht.
Gemeinsam mit Marie besucht Woyzeck eine Schaubude, in der die „Vernunft“ eines Pferdes demonstriert wird; Annäherung zwischen Marie und dem Tambourmajor. Woyzeck ertappt Marie, wie sie sich mit Ohrringen schmückt. Woyzeck beim Doktor, der an ihm die Folgen einer ausschließlichen Ernährung mit Erbsen erforscht. Marie gibt sich dem Tambourmajor hin. Der Hauptmann deutet gegenüber Woyzeck Maries Untreue an; Woyzecks Reaktion wird vom Doktor analysiert. Woyzeck fordert von Marie Rechenschaft. Er beobachtet sie beim Tanz mit dem Tambourmajor. Predigt eines Handwerksburschen („… alles Irdische ist übel, selbst das Geld geht in Verwesung über“). Woyzeck wird von Stimmen verfolgt („stich! stich!“), der Doktor präsentiert ihn seinen Studenten, der Tambourmajor verprügelt ihn. Marie liest in der Bibel die Erzählung von Jesus und der Ehebrecherin. Woyzeck kauft ein Messer; an einem Teich ersticht er Marie. Im Wirtshaus wird Blut an seiner Hand entdeckt; er kehrt zu Maries Leichnam zurück, wirft das Messer in den Teich und folgt ihm; zwei Personen hören einen Ton „wie ein Mensch, der stirbt“.
Die vier handschriftlichen Fassungen enthalten mit unterschiedlicher Gewichtung drei Motivbereiche: das Leiden Woyzecks an halluzinatorischen „Stimmen“ und apokalyptischen Wahrnehmungen („Hörst du das fürchterliche Getöse am Himmel. Über der Stadt. Alles Glut! Sieh nicht hinter dich. Wie es herauffliegt, und alles darunter stürzt“); das von körperlicher Benachteiligung und materieller Not belastete Verhältnis zu Marie; schließlich die Verachtung und Unterdrückung durch übergeordnete Instanzen wie den Hauptmann oder den Arzt, der Woyzeck zu medizinischen Experimenten missbraucht. Der gemeinsame Bezugspunkt ist das soziale Elend Woyzecks. Er selbst drückt das Bewusstsein der Deklassierung in dem Bild aus: „Unsereins ist doch einmal unselig in der und der andern Welt. Ich glaub, wenn wir in Himmel kämen, so müssten wir donnern helfen.“ Auf seinen Mangel an Tugend angesprochen, erwidert er: „Sehn Sie: wir gemeine Leut, das hat keine Tugend, es kommt einem nur so die Natur; aber wenn ich ein Herr wär und hätt ein’ Hut und eine Uhr und eine Anglaise und könnt vornehm reden, ich wollt schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl!“
Sie finden hier online folgende Texte von Georg Büchner:
Quelle: Ernst Klett Verlag GmbH
Ort: Stuttgart
Quellendatum: 2009
Ort: Stuttgart
Quellendatum: 2009