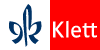Technik unter der Haube - die Kraft, die Räder antreibt
Die schöne Vision vom schadstoffreien Motor - Brennstoffzellen gelten als zukunftsträchtig, doch der Weg in die Wasserstoffgesellschaft ist weit - Ökobilanz noch ungünstig
Die Brennstoffzelle galt in den letzten Jahren als der große Hoffnungsträger für die Autoindustrie. Doch die Euphorie hat merklich nachgelassen - die Probleme haben sich als weit schwieriger herausgestellt als ursprünglich gedacht.
Leise tritt er an, sehr leise sogar, aber keineswegs schwächlich: Wenn der Fahrer des A-Klasse-Mercedes beherzt aufs Beschleunigungspedal tritt - von Gaspedal kann man da ja streng genommen nicht mehr reden -, dann kommt der Kleine auch recht ordentlich in die Gänge. Zwar machen die knapp 90 PS das Auto, das 300 Kilo mehr wiegt als sein Kollege mit Verbrennungsmotor, nicht gerade zu einem Ausbund an Agilität, doch 140 Kilometer pro Stunde sind allemal drin. Und während bei einem herkömmlichen Verbrennungsmotor allerlei übel riechende und eher mehr denn weniger umweltschädliche Abgase aus dem Auspuff rauchen, dampft bei dem Brennstoffzellen-Daimler namens A-f-cell nur Wasser aus dem Röhrchen unter der hinteren Stoßstange. Entstanden ist es in der Brennstoffzelle - englisch fuel cell - aus der so genannten kalten Verbrennung von Wasserstoff und Sauerstoff, wobei neben Wasser auch Strom entsteht (siehe Kasten).
Zwar kann man ein Brennstoffzellenauto wohl noch lange nicht beim Händler kaufen, Prototypen indes gibt es schon heute reichlich. Insgesamt etwa 250 Brennstoffzellenfahrzeuge, so schätzt die EU, bewegen sich heute auf den Straßen der Welt. Rund 60 Unternehmen arbeiten weltweit an der Umsetzung der mobilen Wasserstoffvision. Allein Daimler-Chrysler hat sich zum Ziel gesetzt, neben den 30 umweltfreundlichen Bussen, die seit einem Jahr in zehn europäischen Städten, darunter auch Stuttgart, unterwegs sind, 2004 auch noch 60 zellenbetriebene A-Klasse-Modelle zu Versuchszwecken in den Alltagsverkehr zu bringen. "Die ersten seriennahen Brennstoffzellenautos", wie es bei Daimler bei der Vorstellung dieser Idee im Oktober 2002 hieß - wobei der Stolz über die Pioniertat nicht zu überhören war.
Der Stuttgarter Konzern hat unter allen Autobauern der Welt wohl die meiste Erfahrung mit dieser innovativen Technik. Als vor exakt zehn Jahren mit Necar das weltweit erste Brennstoffzellenfahrzeug der Welt auf den Straßen zwischen Ulm und Stuttgart Premiere feierte, war die Euphorie groß. Damals glaubten die Visionäre der Technologie, dass in zehn Jahren - also heute - die Null-Emissions-Fahrzeuge zu tausenden in Serie produziert werden könnten. Doch diese Euphorie ist mittlerweile gründlich verflogen. Zwar sind sich die Experten einig, dass die umweltfreundliche Brennstoffzelle eines Tages Otto- und Dieselmotor ablösen wird. Doch wann das sein wird, das steht in den Sternen. Nicht ohne Spott wird die Geschichte der kommerziellen mobilen Brennstoffzelle heute schon als "ewige Innovation" gehandelt. Denn trotz aller Anstrengungen sieht die Zukunft eher düster aus. "Wir erwarten, dass die Brennstoffzellentechnologie in acht Jahren in Serie geht und 2020 kommerziell mit Verbrennungsmotoren konkurrieren wird", sagt Herbert Kohler, Forschungsdirektor für Antriebe bei Daimler-Chrysler.
Die Herausforderungen für die Ingenieure sind deshalb so groß, weil sie zum einen die Kosten drastisch senken und zum anderen technisch an vielen Fronten gleichzeitig kämpfen müssen. So besteht zum einen der Katalysator für die notwendige Zerlegung des Wasserstoffs in Kern und Elektron bis jetzt aus dem teuren Platin, eine Alternative ist nicht in Sicht. Ein weiteres kniffliges Problem ist die Membran, durch welche die positiv geladenen Wasserstoffkerne hindurchdiffundieren müssen, damit Strom fließt. Die Zuverlässigkeit und vor allem die Lebensdauer dieser hauchdünnen Folie lässt trotz aller bereits erzielten Erfolge noch sehr zu wünschen übrig. Unerfreulicherweise altert diese Membran merklich, bevor sie ihren Geist ganz aufgibt. In der Praxis bedeutet dies, dass die elektrische Leistung mit der Zeit nachlässt.
Schließlich sind da noch die Kosten. Derzeit ist offenbar nicht einmal ansatzweise eine Lösung in Sicht, wie sich die teuren Zellen so kostengünstig herstellen lassen, dass sie zu einer echten Konkurrenz für den Verbrennungsmotor werden könnten. Da hilft auch der theoretisch beachtlich hohe Wirkungsgrad nicht weiter, weil die zahlreichen Komponenten, die zum Betrieb der Brennstoffzellen nötig sind, einen guten Teil des produzierten Stroms gleich wieder selbst verbrauchen: der Ventilator zum Kühlen der Zellen etwa oder der komplizierte Wasser-, Gas- und Lufttransport.
Doch die Ingenieure lassen sich nicht entmutigen. Unverdrossen tüfteln sie daran, ihre Versuchsbrennstoffzellen technisch für den Alltagsbetrieb fit zu machen. So wurde jüngst ein beachtlicher Erfolg gemeldet: Die Brennstoffzelle von Honda lässt sich noch bei minus elf Grad sicher starten, die neue Daimler-Zelle schafft es gar bei minus 20 Grad. Solche Lichtblicke lassen hoffen, dass die Milliarden Euro, die nicht nur von der Industrie, sondern auch von staatlicher Seite in die Zukunftstechnologie gesteckt werden, gut investiert sind.
Allenthalben wachsen in den Bundesländern üppig mit Forschungsmitteln ausgestattete F-cell-Kompetenzzentren aus dem Boden. Der amerikanische Präsident George W. Bush ist ebenfalls von der Brennstoffzelle und der Wasserstofftechnik angetan. Deshalb investieren die Amerikaner innerhalb von fünf Jahren 1,7 Milliarden Dollar in diesem Sektor. Und auch die Japaner sind vorne mit dabei - bei den Erfolgen, aber auch was das Geldausgeben für diese Technik betrifft.
Europa schließlich soll sich bis 2050, so hat Kommissionspräsident Romano Prodi im EU-Weißbuch des Wasserstoffs im letzten Jahr verkündet, zur Wasserstoffgesellschaft wandeln. Die Brennstoffzelle soll dabei eine tragende Säule sein. Prodis Traum: aus jedem Auspuff kommt Wasser, umweltpolitisch gesehen ein gewaltiges Plus. Doch wie realistisch ist diese Vision?
Das Wasser, das hinten rauskommt, muss nämlich nicht unbedingt einen ökologisch unbedenklichen Ursprung haben: Von den 600 Millionen Tonnen Wasserstoff, die bereits heute pro Jahr hergestellt werden, kommen 98 Prozent aus nicht regenerativen Quellen - aus Erdgas, Öl oder Strom, der mit Hilfe von Kohle oder Atomenergie gewonnen wurde. Mit Strom Wasserstoff zu produzieren, der dann wieder in Strom umgewandelt wird, ist ökologisch gesehen eben nur sehr bedingt sinnvoll.
Quelle: Stuttgarter Zeitung
Autor: Tobias Beck und Klaus Zintz
Verlag: Stuttgarter Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co KG
Ort: Stuttgart
Quellendatum: 14.05.2004
Bearbeitungsdatum: 19.12.2005
Autor: Tobias Beck und Klaus Zintz
Verlag: Stuttgarter Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co KG
Ort: Stuttgart
Quellendatum: 14.05.2004
Bearbeitungsdatum: 19.12.2005