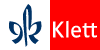Japan leidet unter dem China-Syndrom - Hightech-Industrie wandert zunehmend ins kostengünstigere Reich der Mitte ab
Japan, China, Hightech-Industrie, Betriebsverlagerung, Billiglohn-Land
Sony tut es, NEC immer öfter und nun auch Toshiba. Fast schon im Wochentakt lagert ein japanischer Konzern wichtige Produktionsbereiche nach China aus.
Zuerst waren es nur Fernseher, Kühlschränke, Textilien oder Zulieferungen, die Japans Topfirmen in China produzieren ließen. Jetzt sind es immer mehr Hightech-Produkte wie Computer und Digitalgeräte, die man den Nachbarn auf dem asiatischen Festland anvertraut. Neuerdings sollen sogar Autos von China nach Japan rollen. Isuzu wird der erste japanische Fahrzeughersteller sein, der - zunächst Lastwagen - aus seiner China-Produktion reimportiert.
Auch Japans Autokonzerne, die jetzt noch monatlich so viel in alle Welt liefern, wie ihr Heimatmarkt im ganzen Jahr einführt, ''werden den Weg der übrigen Industrie gehen'', meint Andy Xie, Volkswirt bei Morgan Stanley in Hongkong. ''Es ergibt keinen Sinn, Autos teuer in Japan herzustellen, wenn man sie auch einen Fährtag entfernt in Dailian für einen Bruchteil der Kosten montieren kann.''
Japans Topunternehmen der Elektronikbranche haben sich in China schon reihenweise angesiedelt. Sony eröffnete kürzlich eine neue Fabrik in Wuxi in der Jiangsu-Provinz. Dort produzieren Chinesen das Notebook Vaio, das bisher nur in Japan und in den USA gefertigt wurde. Kurz zuvor hatte das Tokioter Topunternehmen bereits die Herstellung von Teilen für seine Digitalkameras nach Schanghai übersiedelt.
Der Elektronikgigant NEC überraschte unlängst mit der Mitteilung, rund 70 Prozent seiner PC künftig im Reich der Mitte zu bauen, Kameraspezialist Olympus zieht derzeit mit einem Großteil seiner Produktion ins chinesische Industriezentrum Shenzhen um und will von dort in alle Welt exportieren. Dem Abmarsch der Elektronikelite folgen auch Japans Präzisionsmaschinenhersteller. Nidec, Union Tool und Minebea verlagern ebenfalls ins Riesenreich. Erste Konzerne, so konstatiert überrascht Japans führende Wirtschaftszeitung ''Nikkei'', verlegen sogar Forschungs- und Entwicklungsfunktionen in das Nachbarland.
Vorreiter ist die Firma Hitachi, die ihr Pekinger Entwicklungszentrum von derzeit acht Angestellten innerhalb der kommenden drei Jahre auf 40 erhöhen will. Mehr als eine Milliarde Euro investierten Japans Konzerne im Finanzjahr 2000/01 - eine Steigerung von 32 Prozent. In der ersten Hälfte des jetzt zu Ende gehenden Finanzjahres 2001/02 wurden noch einmal über 87 Prozent zulegt.
Die Japaner lockt nicht nur der potenzielle Riesenmarkt vor der Haustür, es ist ihnen daheim längst viel zu teuer geworden. In der zweitgrößten Wirtschaftsnation der Welt arbeitet ein Arbeiter gerade einen Tag für den Lohn, den sein chinesischer Kollege im Monat verdient. Selbst bei hoch qualifizierten Ingenieuren beträgt die Gehaltsspanne noch eins zu zwölf. Günstig für die Japaner sind auch die relativ kurzen Wege in den Billigstandort sowie die Verständigung, die über gleiche oder ähnliche Schriftzeichen erfolgt.
Japanische Manager sehen weitere Vorzüge. Tadashi Matsumoto, China-Direktor von Toshiba, hält es für einen Segen, dass seine Firma auf drei belastende Traditionen in der Heimat keine Rücksicht nehmen müsse: auf lebenslange Anstellung, die Bezahlung nach dem Senioritätsprinzip und die Zwänge der engen Firmenverbindungen. ''In Japan ist es schwer, sich von der moralischen Verpflichtung zu lösen, bei langjährigen Zulieferern einzukaufen. In China können wir uns den preisgünstigsten Anbieter aussuchen.'' Auch die Qualität gibt nicht länger Anlass zur Sorge. ''In manchen chinesischen Niederlassungen gibt es heute schon eine bessere Kontrolle als im japanischen Mutterkonzern'', sagt Analyst Yoko Yoshimoto von der Sanwa-Bank.
Während sich Japans Unternehmen über hohe Profite und die Chinesen über Kapital, Knowhow oder Jobs freuen, schrillen in Japans Politik die Alarmglocken. Nach vorläufigen Schätzungen gingen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im laufenden Finanzjahr rund 650 000 industrielle Arbeitsplätze verloren, seit 1992 mehr als drei Millionen. Wie viele Stellen durch Produktionsverlagerung beziehungsweise durch die Umkehrung der Handelsströme ins Reich der Mitte abflossen, verschweigt die amtliche Statistik. Jesper Koll, Chefvolkswirt bei Merrill Lynch in Tokio, schätzt die Zahl auf mindestens 180 000 - allein durch Direktinvestitionen japanischer Großkonzerne.
''Der Industrie-Exodus nach China schürt in Japan tiefe Ängste'', titelt die Finanzzeitung ''Nikkei''. Wirtschaftsminister Heizo Takenaka nennt ''diesen Megaabmarsch die aktuell bedeutendste Bedrohung unserer Ökonomie, weil er unsere Wettbewerbsfähigkeit aushöhlt''. Koll sieht den Fehler aber eher im fehlenden Willen der Japaner zur Veränderung. ''Da die Standortprobleme, vor allem der Reformstau und die horrenden Personalkosten, nur zögerlich angegangen werden, ziehen Japans Unternehmen weiter ab.''
Um das ''China-Syndrom'' auf sanfte Weise zu erledigen, hat die Tokioter Regierung einen Rat berufen, der Strategien entwerfen soll, wie es sich künftig wieder lohnt, in Japan zu produzieren. Mitglieder sind pikanterweise Manager der zehn führenden Konzerne, die ihrem Land reihenweise den Rücken kehren. Vor den Belegschaften beschwören die Industriekapitäne zwar die drohende Auswanderungsgefahr, in den Vorstandssitzungen zählen aber eher die Vorteile einer Produktion in China.
Quelle: Stuttgarter Zeitung
Autor: Angela Köhler
Verlag: Stuttgarter Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co KG
Ort: Stuttgart
Quellendatum: 10.06.2002
Seite: 14
Bearbeitungsdatum: 16.05.2006
Autor: Angela Köhler
Verlag: Stuttgarter Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co KG
Ort: Stuttgart
Quellendatum: 10.06.2002
Seite: 14
Bearbeitungsdatum: 16.05.2006