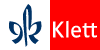FUNDAMENTE-Online
Inhalt
Infoblatt Theorie über die Marktnetze
Theorie der Marktnetze nach August Lösch
Die Theorie der Marktnetze von August Lösch (1906 - 1945) ist den Standortstrukturmodellen zuzuordnen und basiert v. a. auf den Arbeiten von Walter Christaller ("Zentrale Orte"). Lösch versucht mit seinem Konzept die räumliche Verteilung der Produktionsstandorte und die räumliche Produktionsspezialisierung zu erklären. Gleichzeitig liefert er Aussagen zur theoretischen Verteilung von Städten im Raum. Standen in Christallers Studien zu Zentralen Orten noch Versorgungseinrichtungen im Mittelpunkt, so konzentriert sich Lösch auf das Verarbeitende Gewerbe.
Vereinfachende Annahmen und Bedingungen
Der Theorie der Marktnetze sind die folgenden vereinfachenden Annahmen zu Grunde gelegt:
- Es existieren keine räumlichen Unterschiede hinsichtlich der Produktions- und Nachfragefunktionen;
- Produktionsfaktoren und Bevölkerung sind gleichmäßig verteilt;
- Einkommen, Kaufkraft und Bedürfnisse aller Nachfrager sind gleich;
- das Verkehrsnetz ist in alle Richtungen gleich;
- Transportkosten sind direkt proportional zur Entfernung.
- die Standortwahl erfolgt nach dem Prinzip der Nutzenmaximierung;
- die Gesamtfläche ist mit Gütern zu versorgen;
- die Preise der Güter entsprechen den Kosten (vollkommene Konkurrenz);
- die Größe der Wirtschaftsgebiete ist zu minimieren;
- jeder Konsument kauft im nächstliegenden Angebotsort.
Ein Zuordnungsfaktor (K) bezeichnet die Gesamtzahl der mit einem zentralen Gut belieferten Siedlungen. Dieser Zuordnungsfaktor ist je nach Reichweite bzw. Zentralität des angebotenen Gutes variabel. Die sechseckigen Marktgebiete aller Güter erstrecken sich über die unbegrenzte Gesamtfläche und so entsteht pro Gut jeweils ein Netz von Marktgebieten.
Die unterschiedlichen Marktnetze werden nun so übereinander gelegt, dass sie einen gemeinsamen Mittelpunkt bilden (zentrale Großstadt) und so lange rotiert, bis sich die größtmögliche Zahl von Produktionsstandorten überlagert und jeweils sechs Sektoren mit hoher bzw. niedriger Standortdichte entstehen. Auf diese Weise wird die örtlich wirksame Nachfrage maximiert und die Transportkosten sowie die Verkehrslinien werden minimiert.
Eigenschaften der Marktnetze
Das System der Marktnetze hat folgende charakteristische Eigenschaften:
- Die zentralörtliche Hierarchie wird durch variable K-Werte bestimmt. Die Größe der Marktgebiete ist so flexibel an die optimale Betriebsgröße anpassbar.
- Eine Spezialisierung der Produktionsstandorte auf bestimmte Funktionen ist möglich. Die Orte können eine unterschiedliche Produktions- und Angebotsstruktur aufweisen. Orte höherer Zentralität müssen daher, entgegen den Aussagen Christallers, nicht unbedingt die Funktionen der Orte niedrigerer Zentralität aufweisen. Die Beziehungen der Orte untereinander sind somit nicht nur vertikal, sondern auch horizontal ausgerichtet.
- Die Struktur der räumlichen Verteilung der Märkte ist flexibel, unterschieden wird zwischen "städtearmen" und "städtereichen" Sektoren. Die jeweiligen Sektorengrenzen bilden die Hauptverkehrslinien. Innerhalb der Sektoren existieren Märkte unterschiedlicher Zentralität. Tendenziell nimmt mit zunehmender Entfernung von der zentralen Großstadt auch die Größe der zugeordneten Zentren zu.
Kritik an der Theorie der Marktnetze
Die Kritik an der Theorie der Marktnetze konzentriert sich im Wesentlichen auf die unrealistischen Modellannahmen. So verliert die Theorie in der Realität durch Unterschiede in der natürlichen Verteilung der Ressourcen, der Bevölkerung oder der Verkehrserschließung sowie durch politische Einflussfaktoren ihre Gültigkeit. Darüber hinaus werden in der Theorie der Marktnetze entscheidende Bestimmungsfaktoren der wirtschaftlichen Entwicklung wie z. B. externe Ersparnisse oder Güterbewegungen innerhalb und zwischen den Marktnetzen nicht berücksichtigt. Ebenso bleiben Ursachen des Industrialisierungsprozesses weitgehend unberücksichtigt. Es wird nicht deutlich, warum und wie sich Räume industriell entwickeln lassen. Die Theorie der Marktnetze ist daher in der Raumordnungspolitik nur begrenzt anwendbar.
Literatur
BATHELT, H. & J. GLÜCKLER (2002): Wirtschaftsgeographie - Ökonomische Beziehungen in räumlicher Perspektive. Stuttgart.
SCHÄTZL, L. (1993): Wirtschaftsgeographie I. München.
Quelle: Geographie Infothek
Autor: Jutta Henke
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2004
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 02.05.2012
Autor: Jutta Henke
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2004
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 02.05.2012
Klett-GIS
TERRASSE online